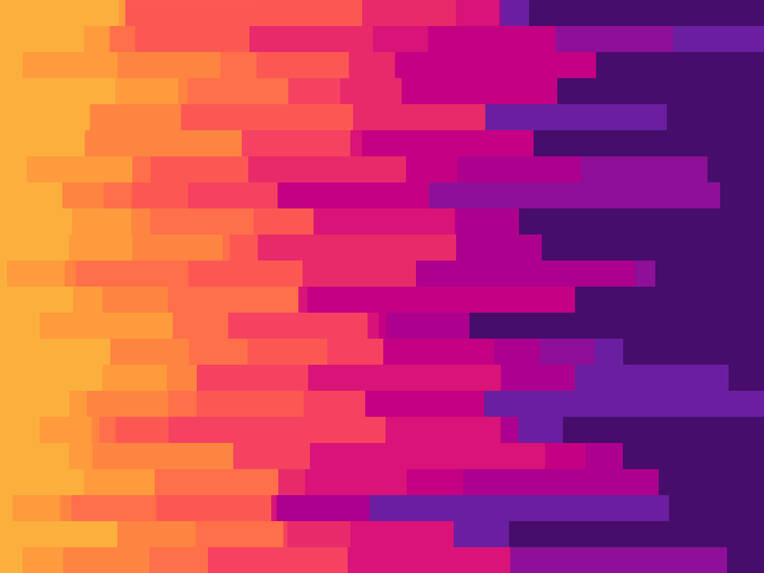Kontinuierliche Nierenersatzverfahren sind fester Bestandteil der Intensivtherapie. Trotz stetig verbesserter Technik hat das therapeutische Team eine Vielzahl an Aufgaben. Neben einem reibungslosen Ablauf ist ein zielgerichtetes Eingreifen schon bei kleinen Störungen und Fehlern notwendig.
Während des Aufenthalts auf der Intensivstation entwickeln etwa 50 % der Patienten eine akute Nierenschädigung. Bei bis zu zwei Dritteln der Betroffenen besteht dadurch die Notwendigkeit einer, oft zeitlich begrenzten, Nierenersatztherapie (NET). Die Ursache dafür ist entweder eine bereits bestehende Nierenfunktionsstörung oder die akute Krankheitsphase selbst [1].
In einer Umfrage der Sektion Niere der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) aus dem Jahr 2020 führen etwa 83 % der befragten Kliniken, die NET anbieten, auch den Aufbau und den Betrieb selbstständig durch, wenngleich es nach wie vor auch das Konzept der konsiliarischen Betreuung durch die Dialyseabteilungen gibt [2]. Laut Willam et al. nehmen etwa 30 % der Ärztinnen und Ärzte und 33 % der Pflegefachpersonen der Intensivstation den Aufbau der NET selbstständig vor. Eine eigenständige Überwachung und Reaktion auf Veränderungen übernehmen 55 % der Pflegefachpersonen und 56 % der ärztlichen Kollegen (Assistenzärzte und Fachärzte) [2]. Obligat ist die Beachtung der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV), die, in Bezug auf Einweisungen, in der Praxis nur rund 49 % der Befragten aus den Bereichen der internistischen Intensiv- und Notfallmedizin rechtskonform und strukturiert einhalten.
Dabei geben Pflegefachpersonen im Vergleich zu Ärzten signifikant häufiger an, rechtskonform eingewiesen zu sein [3]. Es ist unbedingt notwendig, strukturierte Einweisungen und hausinterne SOP (Standard Operating Pocedures) zu etablieren und diese in regelmäßigen interprofessionellen Fortbildungen theoretisch sowie fachpraktisch zu schulen [4].
Simulationstrainings können helfen, die Unterbrechungen der NET zu minimieren [5]. Zuständigkeiten sind im Voraus im interprofessionellen Team zu klären und entsprechend schriftlich zu fixieren. Ein wesentlicher Aspekt einer sicheren Therapieführung ist das „Troubleshooting“, also der Umgang mit Alarmen und dem damit verbundenen Prozess der Diagnosefindung und Fehlerbehebung.
Störungen und Fehler im Rahmen der NET
Dieser Beitrag beschreibt im Folgenden verschiedene Szenarien, die sowohl Patienten als auch Devices verursachen können, und zeigt Lösungsstrategien auf, um wichtige Aspekte zur Patientensicherheit zu verdeutlichen.
Alarm des Zugangsdrucks (Arterieller Druckalarm). Ist im Zusammenhang mit der NET von arteriellen Alarmen die Rede, bezieht sich dies auf die blutgefüllten Bereiche vor dem Filter. Der Zugangsdruck ist negativ, da die Blutpumpe einen Sog auslöst, sodass das Blut aus dem Patienten in das Gerät gelangt.
Gerät der arterielle Druck zu weit ins Negative und verursacht dadurch einen Alarm, kann dies einerseits an den noch verschlossenen Verschlussklemmen am Schlauchsystem liegen oder an Knickstellen im Schlauchsystem. Diese sollten geöffnet und/oder der Knick entfernt werden. Zudem kann ein an der Gefäßwand anliegender Katheter einen Alarm auslösen – zu beheben mit einer leichten Positionsänderung, zum Beispiel einem leichten Zug am Katheter. Dies ist etwa beim klassischen Shaldon-Katheter der Fall.
Bei der Verwendung von Schlitzkompressen als Verband kann es sinnvoll sein, diese für die Behandlung zu entfernen oder zu repositionieren. Eine dünne sterile Abdeckung als Verband lässt den Verlauf des Katheters jederzeit erkennen. Kommen Katheter mit seitlichen Öffnungen zum Einsatz, kann dies bei hoher Blutpumpengeschwindigkeit (hohem Blutvolumenfluss) und hohem negativem Druck beispielsweise zu einer hohen Scherbelastung an den Seitenschlitzen führen. Diese kann die Blutzellen schädigen (Hämolyse) und zur Bildung von Thromben führen, die sich potenziell bei Manipulation am Katheter lösen lassen [6, 7]. Ein dauerhaft hoher negativer Druck von über –200 mmHg ist daher zu vermeiden. Die genaue Kenntnis über den verwendeten Dialysekatheter ist obligat. Regelhaft auf der Station verwendete Katheter sollten in unsteriler Form als Anschauungsmaterial zur Verfügung stehen.
Weiterhin ist es möglich, dass der Dialysekatheter den eingestellten Blutfluss nicht bewegen kann und ebenfalls ein Ansaugen an die Gefäßwand die Folge ist. Daher sind die Herstellerangaben zu berücksichtigen. Neben der ungünstigen Katheterlage im Gefäß ist auch ein zu geringes intravasales Volumenangebot beim Patienten möglich. Als Lösung kann der Blutfluss verringert werden. Das aber führt zu einer niedrigeren Clearence [8]. Eine Volumensubstitution oder eine Reduzierung des Entzuges können unter Umständen notwendig sein. Zur Überbrückung kann man sich mit dem „Umpolen“, also dem temporären Vertauschen von arteriellem und venösem Ansatz zwischen Katheter und Gerät, behelfen, um ein Clotting des Filters durch die stehende Blutpumpe kurzfristig zu vermeiden. Dadurch besteht jedoch die Möglichkeit der Rezirkulation im Katheter, woraus eine ineffektivere Behandlung resultiert. Eine zeitnahe Neuanlage eines Katheters ist in dieser Situation erforderlich [9].
Verschiebt sich der sonst negative Druck ins Positive, kann eine Diskonnektion des Dialysezugangs hierfür die Ursache sein. Bei Shuntnadeln kann dies innerhalb von wenigen Minuten lebensgefährliche Folgen haben. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass Husten einen Sekundäralarm auslöst. Dabei erreicht der kurzfristig positive thorakale Druckanstieg die Alarmgrenze [10].
Alarm des Rückflussdruckes (venöser Druckalarm). Der venöse Druckalarm zeigt die Alarme im System nach dem Filter bis zum Wiedereintritt des Bluts in den Katheter. Dieser Druck sollte stets positiv sein. Bewegt sich der venöse Druck Richtung null, ist er zu niedrig und das System sollte zügig auf Leckagen überprüft werden. Eine mögliche Ursache können undichte Konnektionsstellen zwischen Dialysekatheter und Schlauchsystem sein, die wieder zusammenzuführen sind. Falls es zu einer Diskonnektion am venösen Ende kommt, ist Eile geboten. Abhängig vom Blutfluss können hier innerhalb von Minuten hämorrhagische Zustände eintreten. Eine Leckage im System kann einen Tausch des Systems erforderlich machen. Eine weitere Möglichkeit für einen venösen Druckalarm kann ein fehlender oder unzureichender Kontakt des entsprechenden Druckaufnehmers oder der venösen Luftabscheidekammer sein. Durch die Wiederherstellung dieses Kontakts ist der Druck wieder adäquat messbar [9].
Eine abgeknickte Schlauchleitung oder eine geschlossene Klemme am venösen Schenkel führen ebenfalls zum Erreichen der oberen Druckgrenzen. Dies sollte durch die Öffnung der Klemme oder auch durch das Entfernen des Knicks zügig behoben werden [10].
Ein weiteres Problem, das sich mit einer Erhöhung des venösen Drucks ankündigt, ist die Bildung von Gerinnseln im venösen Blasenfänger. Mehrere Faktoren beeinflussen die Koagelbildung im extrakorporalen System. Dazu zählen unter anderem die Standzeit der NET, das Zusammenspiel von Kathetertyp und Blutflussgeschwindigkeit sowie die Blutzusammensetzung/Viskosität. Letztere wird durch die Erkrankung selbst sowie durch die Antikoagulation am Gerät beeinflusst. Daher sind regelmäßige Kontrollen von Gerät, Gerinnung und Elektrolytzusammensetzung in Bezug auf die Antikoagulation ein wichtiger Sicherheitsfaktor.
Die Blutflussgeschwindigkeit kann ebenfalls Einfluss auf den venösen Druck haben, wenn der Dialysekatheter im Lumen eingeschränkt ist oder sich Koagula im System gebildet haben. Der venöse Druck kann in diesem Zusammenhang aufgrund eines hohen Blutflusses steigen. In diesem Fall ist die Blutflussgeschwindigkeit anzupassen, mit den bereits erwähnten negativen Auswirkungen auf die Therapieeffektivität [9].
Luftalarm. Erkennt der Luftdetektor vermeintliche Luftblasen, wird Luftalarm ausgelöst. Dieser Detektor ist eine Vorrichtung, die einen Unterschied zwischen dunklen und hellen Blasen erkennt. Dies ist ein Sicherheitsmechanismus zur Vermeidung einer Luftembolie. Im Laufe der Therapie kann sich der Blutspiegel im venösen Blasenfänger absenken. Dadurch kann Luft ins System gelangen. Ein manuelles Erhöhen des Blutspiegels kann dem entgegenwirken. Zudem besteht bei einigen Geräten die Möglichkeit, dass sich der Schlauch aufgrund der Wärmeentwicklung des Bluts aus seiner Halterung herauslöst. Das lässt sich durch vorsichtiges Wiedereinfädeln beheben. Der Pegelstand ist mindestens bei jeder Antrittskontrolle zu überprüfen. Sollte Luft im venösen System sein, ist ein Austausch des Sets notwendig [10].
Probleme am Filter. Alarme, die den Filterdruck (Transmembrandruck, TMP) betreffen und vor allem mit der Erhöhung dessen einhergehen, zeigen an, dass es zum „Clotting“ oder „Glogging“ im Filter oder auch im venösen Bubble Catcher kommt.
Merke: TMP = Druck auf der Seite der Membran, wo die Filtration stattfindet − Druck auf der Seite der Membran, wo das Filtrat landet.
Die Blutgerinnung innerhalb des extrakorporalen Systems wird als Clotting bezeichnet. Verstopfen im Rahmen dieses Clottings die Poren der semipermeablen Membran, handelt es sich um Glogging [8]. Daraus resultiert ein Effektivitätsverlust der NET [11]. Ein Wechsel des Systems ist hier meist unumgänglich. Die Reduzierung des Blutflusses verringert in dieser Situation den TMP und verschafft die notwendige Zeit für eine geplante Rückführung des Bluts mit anschließender Trennung des Systems. Es ist relevant, wie schnell sich der TMP aufbaut. Ein schleichender Vorgang über Tage deutet auf normalen Verschleiß des Filters hin. Bei einem sprunghaften Anstieg innerhalb von wenigen Minuten oder Stunden ist das Problem meist die Antikoagulation am Gerät, die zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen ist [10].
Blut-Leck-Alarm. Ein Alarm des Blutdetektors kann auf eine Filterruptur hinweisen. Dadurch kann es zur Verschiebung von Blut ins Dialysat kommen. Da die Wasserseite jedoch keine keimfreie Flüssigkeit ist, darf dies nicht passieren. Zur Überprüfung der Echtheit des Alarms ist etwas Dialysat aus dem dafür vorgesehenen Entnahmepunkt zu nehmen und auf okkultes Hämoglobin zum Beispiel mittels eines Hämoccult-Tests zu untersuchen. Dies ist ein häufig verwendetes Testkit. Es enthält Guajak, eine chemische Substanz, die bei Kontakt mit Blut eine bläuliche Farbreaktion zeigt. Wenn es sich um Blut handelt, ist das Set unverzüglich auszutauschen [10].
Skills zur Alarmbehebung notwendig
Bei der Vielzahl von Alarmen und deren Ursachen ist es wichtig, die erforderlichen Skills zur Alarmbehebung zu haben. Die Zuständigkeiten in der Therapieführung sind zu klären, um schnell und effektiv handeln zu können. Wenn es notwendig ist, müssen alle an der Behandlung Beteiligten wissen, wer befugt ist, Veränderungen am Gerät vorzunehmen. Dafür ist neben umfangreichem Wissen viel Erfahrung erforderlich. Checklisten und SOP können ein hilfreiches Tool sein, um Sicherheit zu vermitteln. Zusätzliche multiprofessionelle Fortbildungen und Teamtrainings sind im Sinne maximaler Patientensicherheit jedoch unabdingbar und besonders effektiv.
[1] Ronco C, Bellomo R, Kellum JA. Acute kidney injury. Lancet 2019; 394 (10212): 1949–1964
[2] Willam C, Meersch M, Herbst L et al. Aktueller Stand der Durchführung von Nierenersatztherapien auf deutschen Intensivstationen. Med Klin Intensivmed Notfmed 2022; 117 (5): 367–373
[3] Naendrup JH, Hertrich AC, Briegel J et al. Einarbeitung in der Intensiv- und Notfallmedizin in Deutschland. Med Klin Intensivmed Notfmed 2024; 107: 249–254
[4] Hermes C, Ochmann T, Keienburg C et al. S1-Leitlinie Intensivpflegerische Versorgung von Patient:innen mit [infarktbedingtem] kardiogenen Schock (2022). Im Internet: register.awmf.org/assets/guidelines/113-002l_S1_ Intensivpflegerische-Versorgung-PatientenInnen-mit-Infarkt bedingten-kardiogenen-Schock_2022-05.pdf; Zugriff am 02.03.2024
[5] Lemarie P, Husser Vidal S et al. High-Fidelity Simulation Nurse Training Reduces Unplanned Interruption of Continuous Renal Replacement Therapy Sessions in Critically Ill Patients: The SimHeR Randomized Controlled Trial. Anesth Analg 2019; 129 (1): 121–128
[6] Moore HL. Side holes at the tip of chronic hemodialysis catheters are harmful. J Vasc Access 2001; 2 (1): 8–16
[7] Wachter DS de, Weijmer MC, Kaušylas M et al. Do Catheter Side Holes Provide Better Blood Flows? Hemodial Int 2002; 6 (1): 40–46
[8] Baldwin I, Jones D, Carty P et al. Continuous Renal Replacement Therapy Without Anticoagulation: Top Ten Tips to Prevent Clotting. Blood Purif 2020; 49 (4): 490–495
[9] Chrysochoou G, Marcus RJ, Sureshkumar KK et al. Renal replacement therapy in the critical care unit. Crit Care Nurs Q 2008; 31 (4): 282–290
[10] Breuch G, Hrsg. Fachpflege Nephrologie und Dialyse, 5. Aufl. Elsevier Urban & Fischer, München, 2014
[11] Heise D. Kontinuierliche Nierenersatzverfahren auf der Intensivstation, 1. Aufl. Springer Berlin Heidelberg; Imprint Springer, Berlin, Heidelberg, 2021