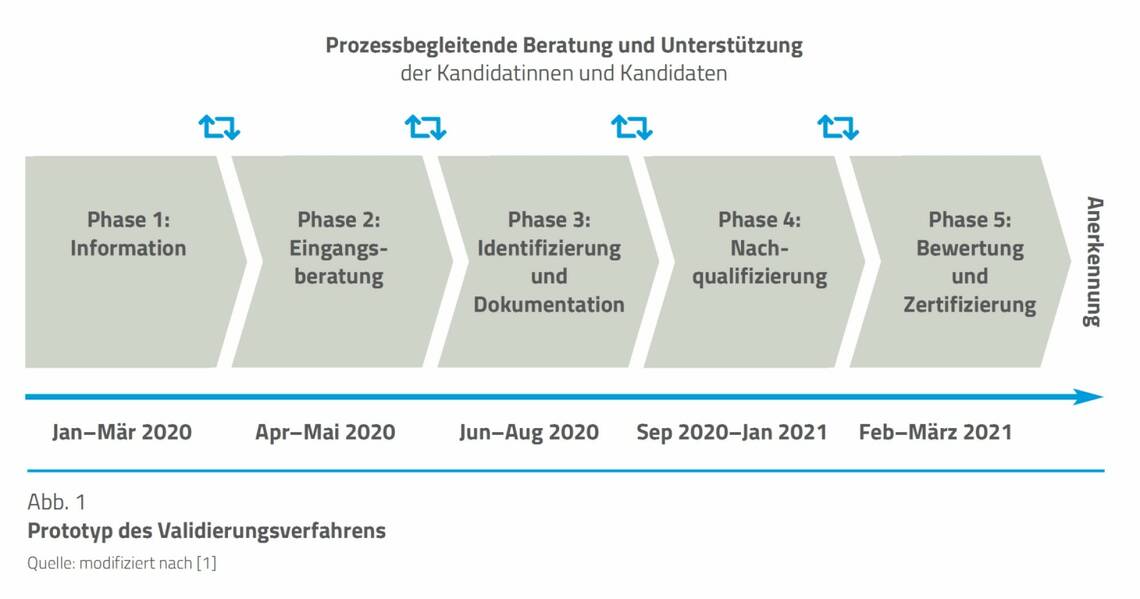Ein Forschungsprojekt im Auftrag des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) untersucht die Gründe für Ausbildungsabbrüche in der Pflege. Die Autorinnen und Autoren präsentieren erste Ergebnisse des noch bis Mitte 2024 laufenden Projekts.
Angesichts des enormen Fachpersonalmangels gewinnt die Frage der Ausbildungsabbrüche in der Pflege an Bedeutung, denn jeder verhinderte Ausbildungsabbruch stärkt die Effizienz des Ausbildungssystems und erhöht das Fachkräftepotenzial. Daher untersucht ein Konsortium aus der Unternehmensberatung Contec, dem IEGUS – Institut für europäische Gesundheits- und Sozialwirtschaft und dem Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik (ISG) im Auftrag des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) die Motive für Ausbildungsabbrüche in der Pflege mittels quantitativer und qualitativer Methoden. Ziel ist, Maßnahmen zur Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen herauszuarbeiten. Das Projekt „Analyse von Maßnahmen zur Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen in der Pflege“ ist im September 2021 gestartet und läuft noch bis Mitte kommenden Jahres.
Der quantitative Baustein des Projekts besteht aus einer Panelbefragung von Pflegeauszubildenden über drei Wellen im Abstand von sechs Monaten. Der qualitative Baustein umfasst qualitativ-biografische Interviews mit Ausbildungsabbrecherinnen und -abbrechern. Durch die Kombination beider Bausteine sollen die zentralen Gründe für Ausbildungsabbrüche sowie Typen von Ausbildungsabbrechern erarbeitet werden. Die Erkenntnisse aus dem Projekt und die Ergebnisse weiterer Projekte aus dem Forschungsprogramm des BIBB sollen in einer Workshopreihe aufgegriffen und mit Fachpersonen aus den Lernorten Schule und Praxis diskutiert werden sowie letztlich der Weiterentwicklung der beruflichen und hochschulischen Pflegeausbildung dienen.
Ausbildungserwartung entspricht häufig nicht der Realität
Derzeit befinden sich sowohl die Panelbefragung von Auszubildenden als auch die Interviews in der Erhebungs- beziehungsweise frühen Analysephase. Die dritte und letzte Welle der Panelbefragung ist für April 2023 geplant, die Rekrutierung von Interviewpersonen und die qualitativ-hermeneutische Auswertung des Interviewmaterials erfolgen voraussichtlich bis Ende des Jahres. Aktuell liegen bereits Auswertungen der ersten Welle der standardisierten Befragung vor, an der sich knapp 2.000 Auszubildende aus Baden-Württemberg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt beteiligt haben.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Anforderungen und Rahmenbedingungen der Pflegeausbildung nach Inkrafttreten des Pflegeberufegesetzes als sehr anspruchsvoll empfunden werden. Viele Auszubildende erleben einen „Praxisschock“: Sie machen häufig die Erfahrung, dass ihre Erwartungen an die Pflegeausbildung nicht der Realität entsprechen. Insbesondere die körperlichen und psychischen Belastungen der Ausbildung werden von der Mehrheit der Befragten unterschätzt sowie die Qualität der Anleitung als schlechter als erwartet eingeschätzt, wie Abbildung 1 zeigt.
Der Praxisschock hängt wiederum eng damit zusammen, ob sich die Auszubildenden Gedanken darüber machen, die Ausbildung vorzeitig abzubrechen. Unsere Daten deuten darauf hin, dass die Ausbildung desto mehr infrage gestellt wird, je stärker Erwartungen und Wirklichkeit auseinanderklaffen – also desto größer der Praxisschock ausfällt. Abbruchgedanken sind häufig die Folge.
In welchem Ausmaß die Auszubildenden diese belastende Erfahrung machen, ist unabhängig von ihrem Alter oder Schulabschluss. Männliche Auszubildende scheinen seltener von einem Praxisschock betroffen zu sein, Menschen mit Migrationshintergrund etwas häufiger. Insgesamt sind die Unterschiede zwischen diesen Gruppen aber gering.
Deutlich zeigt sich dagegen, dass Pflegeauszubildende im zweiten Ausbildungsjahr einen stärkeren Praxisschock erleben als Auszubildende im ersten Jahr. Anzunehmen ist, dass die Anforderungen durch häufigere Praxisphasen und die zunehmende Verantwortungsübernahme im Verlauf der Ausbildung ansteigen und Auszubildende dabei vor größere Herausforderungen stellen als ursprünglich erwartet. Der Praxisschock ist daher weniger als ein kurzfristiges Phänomen einzustufen als vielmehr ein Gefühl, das sich mit der Zeit intensiviert.
Ausbildungsbedingungen optimieren
Weitere Analysen legen den Schluss nahe, dass bestimmte Maßnahmen der Berufsorientierung – Gespräche mit Lehrpersonen, Berufsberaterinnen und -beratern sowie Pflegefachpersonen –, aber vor allem einschlägige praktische Vorerfahrungen den Praxisschock potenziell verringern können. Dasselbe gilt für den Fall, dass die Befragten die Ausbildung in der Pflege als Wunschberuf bezeichnen und sich vor allem vielfältige Tätigkeitsfelder und einen krisenfesten Job wünschen.
Ein ausgeprägterer Praxisschock zeigt sich hingegen bei Auszubildenden, die besonderen Wert auf eine ausgeglichene Work-Life- Balance legen. Berücksichtigt man die mit dem Praxisschock einhergehenden Abbruchgedanken scheint die Ausbildung letztlich – trotz reformierter Ausbildungsbedingungen und zunehmend zur Verfügung stehenden Unterstützungsmaßnahmen – für Teile der Auszubildenden überfordernd zu sein.
Eine gezielte und fundierte Berufsorientierung und praktische (Vor-)Erfahrungen können nach unseren Erkenntnissen dabei helfen, ein realistisches Bild von der Berufstätigkeit in der Pflege zu gewinnen und so einen Praxisschock abzumildern. Bestimmte Prioritäten in der Berufswahl, etwa in Bezug auf Beschäftigungssicherheit und Vielseitigkeit, führen ebenfalls dazu, dass der Praxisschock geringer ausfällt. Es sind aber nicht zuletzt die Ausbildungsbedingungen, die Betreuung und Unterstützung von Auszubildenden, insbesondere in den Praxisphasen, die weiterhin zu optimieren sind.
Unsere Forschung ist bislang in einer frühen Phase. Viele Erhebungen und Auswertungen stehen noch aus. Vor Beginn des Pilotprojekts im Sommer 2023 werden die hier präsentierten Befunde und weitere Forschungsergebnisse in konkrete Präventionsmaßnahmen übersetzt, die von Pflegeschulen und/oder Trägern der praktischen Ausbildung aufgegriffen und erprobt werden können.