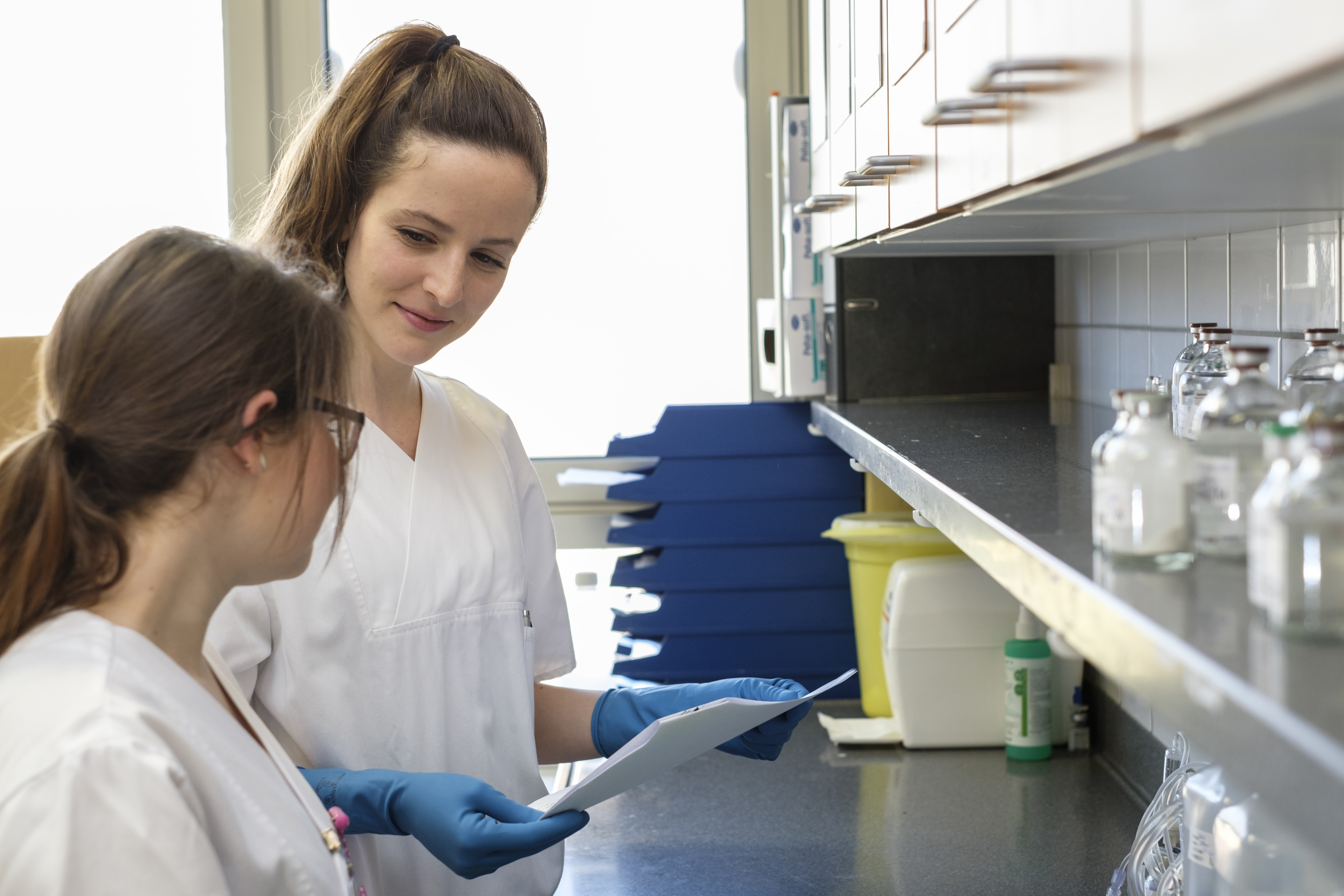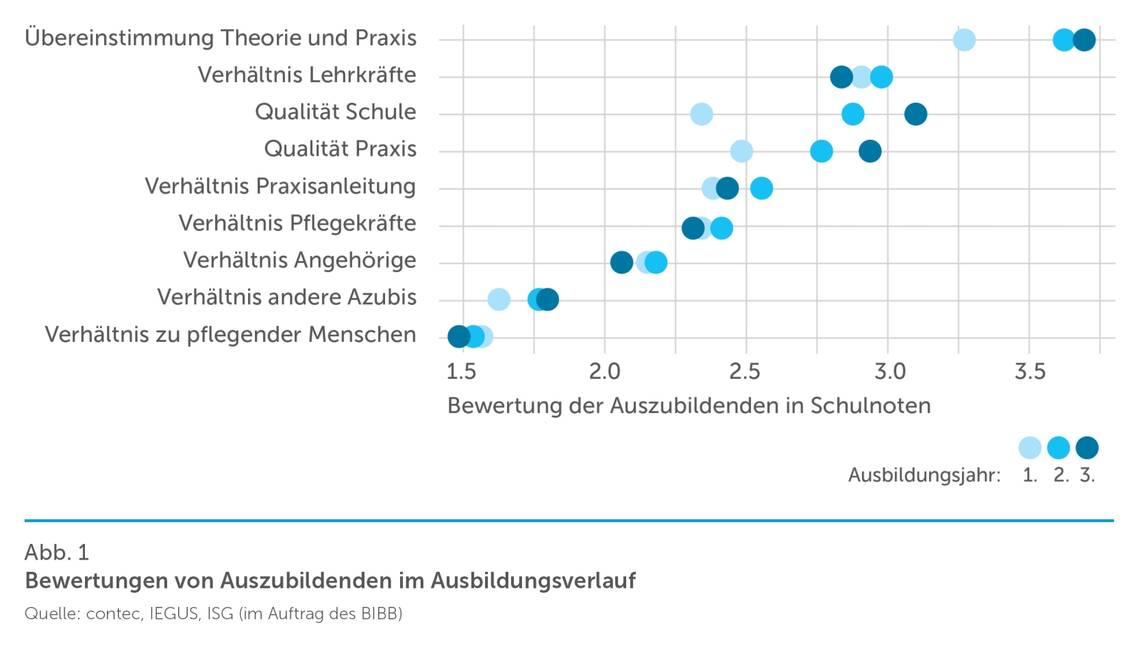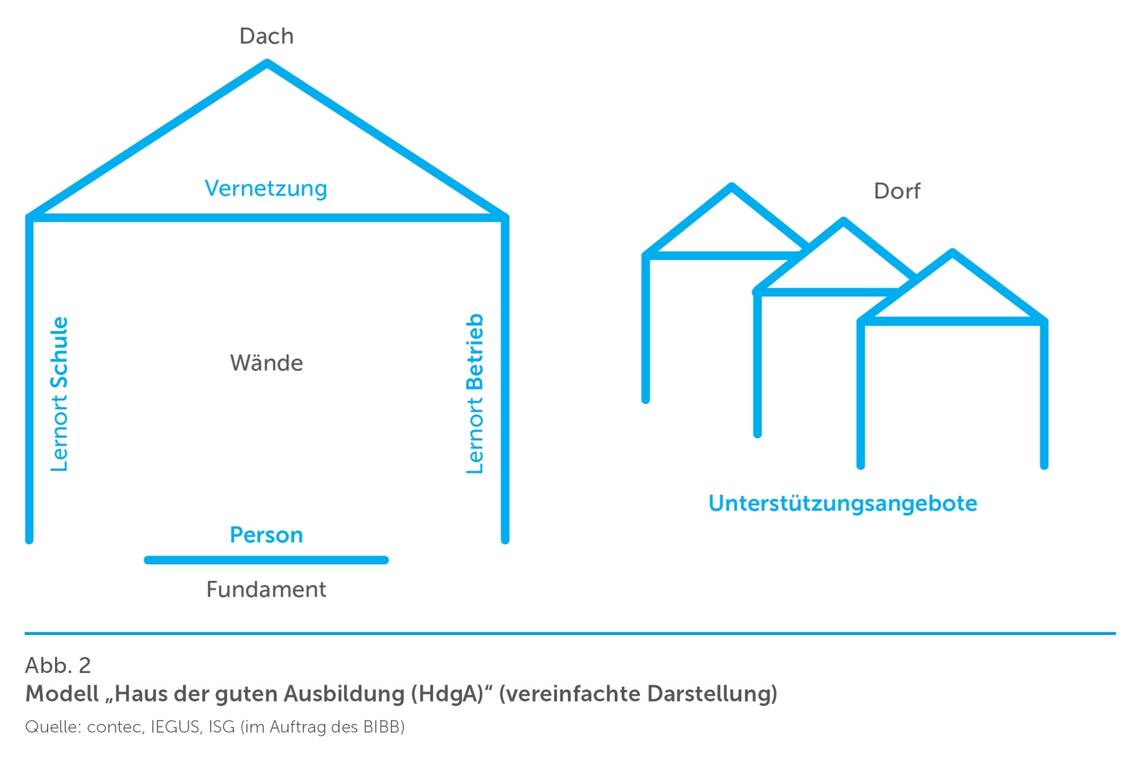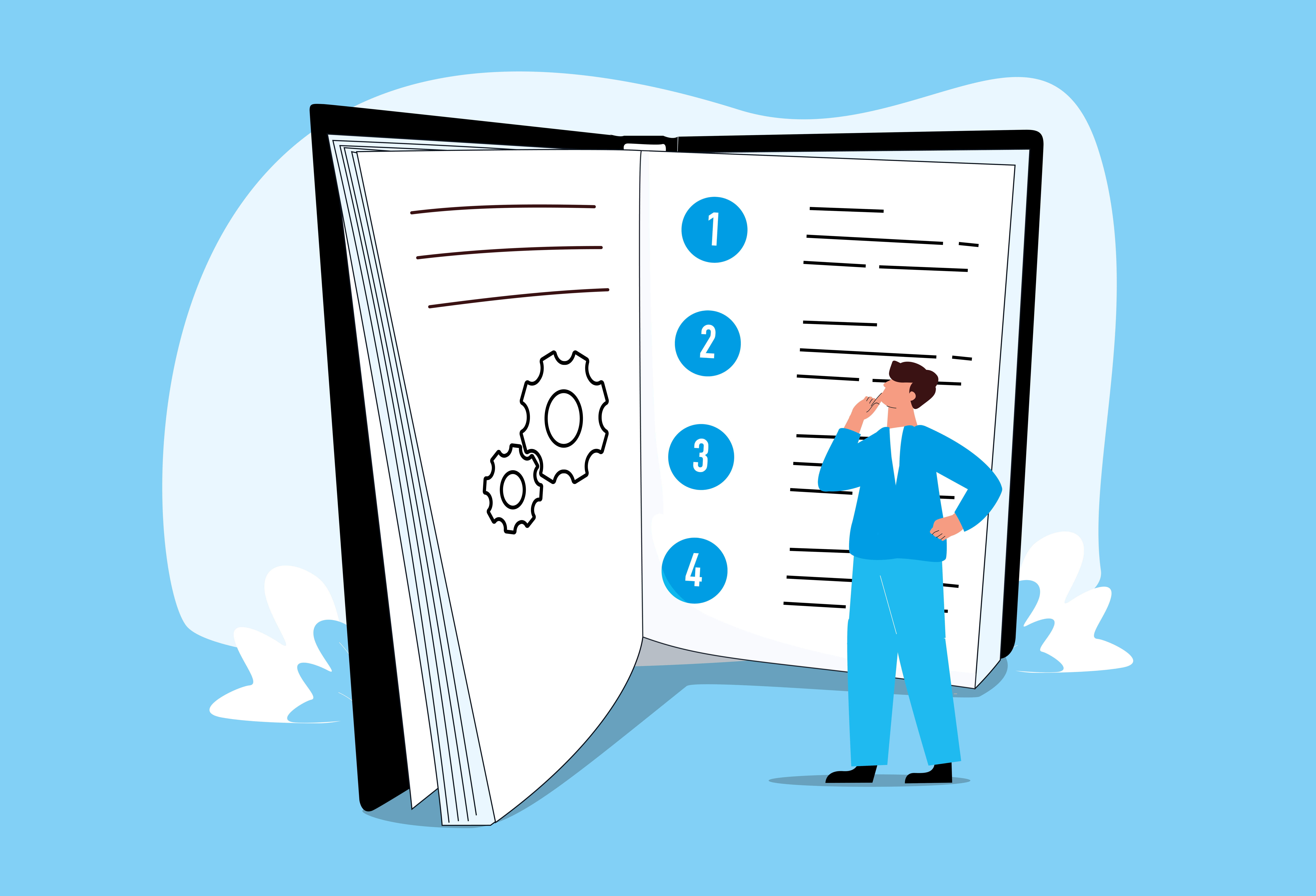Vorzeitige Vertragslösungen und Ausbildungsabbrüche sind ein drängendes Problem. Ein Forschungsprojekt im Auftrag des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) untersuchte die Ursachen und mögliche Lösungsansätze.
Die generalistische Pflegeausbildung wurde 2020 eingeführt, um die beruflichen Perspektiven in der Pflege zu verbessern und den Fachkräftemangel zu bekämpfen. Dennoch bleiben die Zahlen der vorzeitigen Vertragslösungen und Ausbildungsabbrüche ein drängendes Problem. Ein Konsortium aus der Unternehmens- und Personalberatung contec, dem IEGUS (Institut für europäische Gesundheits- und Sozialwirtschaft) und dem ISG (Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik) führte deshalb von 2021 bis 2024 im Auftrag des Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) das Forschungsprojekt „Analyse von Maßnahmen zur Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen in der Pflege“ durch, um die Ursachen zu untersuchen und Maßnahmen zur Prävention von Ausbildungsabbrüchen zu entwickeln [1].
Dem „Praxisschock“ entgegenwirken
Die Ergebnisse verdeutlichen, dass Ausbildungsabbrüche durch eine Kombination aus individuellen, strukturellen und institutionellen Faktoren reduziert werden können. Eine zentrale Erkenntnis der Studie ist, dass Ausbildungsabbrüche in der Pflege ein vielschichtiges Phänomen sind. Eine Panelbefragung im Rahmen des Projekts zeigte, dass fast die Hälfte der Auszubildenden zur Pflegefachfrau, zum Pflegefachmann oder zur Pflegefachperson häufig oder gelegentlich darüber nachdenkt, die Ausbildung abzubrechen. Ein Hauptgrund ist der häufig diskutierte „Praxisschock“ – die Diskrepanz zwischen den Erwartungen und der Realität der schulischen Ausbildung und Praxiseinsätze (Die Schwester | Der Pfleger 5/2023). Aus internationaler Sicht ist dies kein neues Phänomen: In den USA erschien bereits 1974 eine wissenschaftliche Arbeit dazu [2].
In der Panelbefragung gab die Mehrheit der Auszubildenden an, die körperliche und psychische Belastung der Pflegeausbildung unterschätzt zu haben (Abb. 1). Es wurden aber auch Faktoren identifiziert, die einem Praxisschock entgegenwirken können. Hierzu zählen sowohl manche Formen der Berufsorientierung wie Gespräche mit Eltern, Lehrpersonen und Berufsberatung als auch praktische Vorerfahrungen in der Pflege vor Beginn der Ausbildung.
Ausbildungsabbrüche erfolgen oft relativ früh im Ausbildungsverlauf. Doch die Befragungen im Rahmen des Projekts zeigten, dass die Ausbildungszufriedenheit auch nach dem für Abbrüche oft kritischen ersten Jahr weiter abnimmt. Vor allem die Bewertung der Übereinstimmung der Theorie mit der Praxis sowie des Verhältnisses zu den Lehrenden verschlechtert sich im Laufe der Ausbildung merklich. Aus der Längsschnittperspektive erscheint der Praxisschock fast wie eine schleichende Entfremdung mancher Auszubildender. Dies spiegelt sich auch in dem Befund wider, dass die Überlegungen, die Ausbildung abzubrechen, im Verlauf der Ausbildung eher zunehmen. Auffällig ist aber auch, dass Auszubildende das Verhältnis zu anderen Auszubildenden und zu den zu pflegenden Menschen konstant als gut bewerten (Abb. 1).
Was ist für eine erfolgreiche Ausbildung entscheidend?
Zur Strukturierung von Präventionsmaßnahmen entwickelte das Projektteam unter Mitwirkung von Praxisanleitenden und Pflegefachpersonen das Modell „Haus der guten Ausbildung (HdgA)“ (Abb. 2). Dieses betrachtet verschiedene Ebenen, die für eine erfolgreiche Ausbildung entscheidend sind. Die individuellen Voraussetzungen wie Motivation, Resilienz und berufliche Orientierung der Auszubildenden bilden das „Fundament“ des HdgA. Die „tragenden Wände“ sind die beiden Lernorte Schule und Träger der praktischen Ausbildung, die eng zusammenarbeiten sollten. Das „Dach“ entsteht durch die Koordination und Vernetzung zwischen Theorie und Praxis. Zusätzliche Unterstützungsstrukturen wie externes Mentoring, soziale Beratung oder finanzielle Hilfen werden durch das „Dorf“ symbolisiert (Abb. 2).
Ein zentraler Aspekt des Modells ist die Vernetzung der verschiedenen Akteure, um eine kohärente Ausbildungsstruktur zu schaffen, die sowohl die individuellen Bedarfe der Auszubildenden als auch die institutionellen Rahmenbedingungen berücksichtigt.
In der Pilotphase des Forschungsprojekts wurden in zehn ausbildenden Einrichtungen konkrete Präventionsmaßnahmen aus dem HdgA-Modell abgeleitet und erprobt. Am Lernort Schule wurden beispielsweise Vertrauenslehrpersonen und Lernentwicklungsgespräche installiert. Es wurden außerdem Workshops zur Stärkung der Resilienz angeboten und Bewältigungsstrategien curricular verankert. Darüber hinaus wurden Lehrangebote für verschiedene Lernbedarfe geschaffen.
Am Lernort Betrieb gab es unter anderem eine intensivierte Betreuung in der Praxisphase, regelmäßige Lernstandsgespräche sowie eine Verankerung der Ausbildung in Teamrunden und Dienstbesprechungen. Zusätzlich fanden Schulungen von Praxisanleitenden zur besseren Begleitung der Auszubildenden statt. Die Netzwerkmaßnahmen beinhalteten zum Beispiel den Aufbau eines Unterstützungsnetzwerks für Auszubildende, Erfolgskonferenzen zur Reflexion von Lernfortschritten sowie eine bessere Kooperation zwischen den Schulen und Betrieben.
Ganzheitlicher Blick ist entscheidend
Die begleitende Evaluation zeigte, dass besonders solche Maßnahmen positiv bewertet wurden, die individuelle Unterstützung mit strukturellen Verbesserungen kombinierten. Erfolgskritische Faktoren waren die Akzeptanz der Maßnahmen innerhalb der Einrichtungen sowie die Bereitschaft, Ausbildungsprozesse aktiv weiterzuentwickeln und in die hierfür notwendigen Ressourcen zu investieren. Auch wenn die angestoßenen Veränderungen Zeit brauchen, um eine messbare Wirkung zu entfalten, wurden die bereits erzielten Fortschritte von den Verantwortlichen in den Einrichtungen überwiegend positiv bewertet. Im Idealfall wurde mit den Maßnahmen ein langfristiger Prozess der Weiterentwicklung in den Einrichtungen angestoßen, der auch nach der Erprobung fortgeführt wird.
Das Forschungsprojekt hat gezeigt, dass die teilnehmenden Lernorte einrichtungsspezifische Präventionsmaßnahmen positiv bewerten und darin Potenziale sehen, um Ausbildungsabbrüchen gezielt vorzubeugen. Entscheidend ist aus Sicht des Projektteams ein ganzheitlicher Blick, der individuelle, institutionelle und soziale Faktoren gleichermaßen berücksichtigt.
Mögliche Ansatzpunkte zeigt das HdgA-Modell für die Praxis auf: Unterstützung in Form individueller Beratung und Mentoring sollte möglichst früh – am besten mit Beginn der Ausbildung – erfolgen. Wichtig sind eine gute Verzahnung von Theorie und Praxis mit praxisnahen Ausbildungsinhalten sowie eine verbesserte Begleitung durch Praxisanleitende durch gezielte Fortbildungen zur Ausbildungsbetreuung. Hilfreich ist zudem die Stärkung der sozialen und psychologischen Betreuung durch die Bereitstellung von Sozialberatungen und Resilienztraining. Regelmäßige Reflexionsgespräche mit den Beteiligten sollten ebenfalls zum Standard werden. Auf diese Weise lässt sich Ausbildungsabbrüchen gezielt entgegengewirken und die Pflegeausbildung nachhaltig stärken.
Der Abschlussbericht des Forschungsprojekts und weitere Informationen zum Thema finden sich auf der Website des BIBB unter www.bibb.de/pflege-ausbildungabbrueche.
Ein Handbuch auf der Basis der beschriebenen Erkenntnisse aus dem Projekt ist in Vorbereitung.
[1] Fuchs P, Mielenz MO, Seidel K et al. Analyse von Maßnahmen zur Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen in der Pflege. Erfahrungen aus Pilotprojekten zur Abbruchprävention. Bonn: Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB); 2025
[2] Kramer M. Reality Shock. Why Nurses Leave Nursing. St. Louis: C. V. Mosby Company; 1974