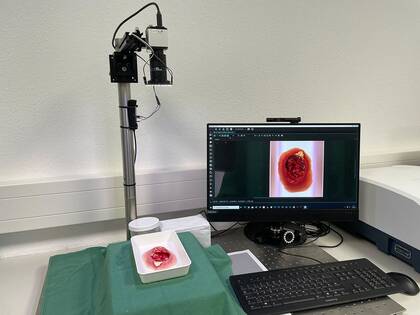Die IU Internationale Hochschule (IU) entwickelt einen KI-gestützten Anamnese-Bot für die Pflegeausbildung – und stößt damit bei Studierenden auf große Zustimmung. Warum der virtuelle Bot das praxisnahe Lernen verbessert, welche Chancen – aber auch Risiken – das Tool für die Fortbildung und Digitalisierung bietet, erläutert die IU-Professorin für Pflege und examinierte Krankenschwester Katharina Rädel-Ablass im Interview.
Frau Professorin Rädel-Ablass, wie kam es zur Entwicklung des KI-gestützten Anamnese-Bots an der IU Internationalen Hochschule?
Die Entwicklung des KI-gestützten Anamnese-Bots an der IU Internationalen Hochschule wurde durch die Herausforderungen in der Ausbildung zur Anamneseerhebung angestoßen. Traditionelle Trainingsmethoden wie Rollenspiele mit Schauspieler:innen oder echten Patient:innen sind oft mit hohem Zeit- und Ressourcenaufwand verbunden, weisen Inkonsistenzen auf und sind nicht leicht in Online-Lernszenarien zu integrieren. KI-basierte Modelle bieten hierfür eine skalierbare, flexible und jederzeit verfügbare Lösung, um diagnostische und kommunikative Fähigkeiten in einer sicheren Umgebung zu trainieren und so die berufliche Handlungskompetenz zu erweitern sowie selbstgesteuertes Lernen zu fördern. Die IU hatte schon früh KI-Konzepte in ihren Studienalltag integriert. Dies führte zum Projekt „Entwicklung von KI-basierten Patient:innenmodellen für das interprofessionelle Lernen in den Gesundheitsstudiengängen", ein Projekt von acht Professorinnen der Virtuellen Hochschulklinik der IU.
Welche Lücke in der pflegerischen Ausbildung soll der Bot konkret schließen?
Der Bot schließt primär die Lücke im praxisnahen Training von Anamnesegesprächen, insbesondere im Kontext der Herausforderungen traditioneller Methoden in der pflegerischen Ausbildung. Dies umfasst das Üben einer Vielzahl von Szenarien, die auch seltene oder komplexe Fälle abdecken, und fördert die interprofessionelle Zusammenarbeit in einer sicheren Lernumgebung. Der Bot schließt bestehende Lücken, indem er Studierenden eine sichere und flexible Umgebung zum Üben gezielter Gesprächsführung und Informationssammlung in verschiedenen Szenarien bietet. Virtuelle Patient:innen sind dabei jederzeit und ortsunabhängig verfügbar, was insbesondere für berufsbegleitende Online-Studiengänge den Zugang zu hochwertiger Bildung erleichtert und flexibles Lernen ermöglicht. Da virtuelle Patient:innen nach einmaliger Einrichtung konsistente Antworten liefern und keine regelmäßige Schulung benötigen, sind sie langfristig kosteneffizienter als Trainings mit realen Patient:innen oder Schauspieler:innen.
Wie realitätsnah sind die simulierten Patientengespräche – auch im Hinblick auf Emotionen, nonverbale Signale oder psychosoziale Herausforderungen?
Die Realitätsnähe der simulierten Patientengespräche wird von den Studierenden überwiegend positiv bewertet. In unserer Studie empfanden 73,6 Prozent der Teilnehmer:innen die textbasierte Version bereits als „ziemlich bis sehr realitätsnah“ im Vergleich zu echten Anamnesegesprächen. Die sprachlichen Fähigkeiten und die Präzision der Antworten des Chatbots wurden durchweg positiv beurteilt, mit einer mittleren Zufriedenheitsrate von 81,1 Prozent für die Verständlichkeit und Antwortfähigkeit. Mehr als 78 Prozent der Befragten bewerteten die fachliche und inhaltliche Präzision als gut bis sehr gut. Hinsichtlich der Emotionen und nonverbalen Signale sind die Möglichkeiten eines rein textbasierten Bots allerdings naturgemäß begrenzt. Studierende nannten dies als Kritikpunkte, da Elemente wie Artikulation, emotionale Ausdrucksfähigkeit und Mimik fehlen. Jedoch kann der Bot durch detaillierte Prompts angewiesen werden, eine bestimmte Grundstimmung oder emotionale Färbung des Patienten zu simulieren, wie Nervosität oder Unsicherheit, und auch umgangssprachliche Äußerungen zu verwenden. Die Variabilität der Antworten, auch in emotionaler Hinsicht, wie die Erwähnung von Erschöpfung oder Müdigkeit durch den Bot, trägt ebenfalls zur Realitätsnähe bei. Bei psychosozialen Herausforderungen ermöglicht der detaillierte „External Context“ des Prompts die Beschreibung des Lebensumfelds, der Pflegesituation und des sozialen Gefüges des fiktiven Charakters. Die Einbeziehung weiterer Rollen, wie der Ehefrau des Patienten, erhöht die Komplexität und Realitätsnähe der Gesprächssituation erheblich, was von den Studierenden positiv bewertet wurde.

Welche pflegerischen Kompetenzen lassen sich mit dem Bot besonders gut trainieren – und welche eher weniger?
Der Anamnese-Bot eignet sich hervorragend zum Training der Anamneseerhebung, kommunikativen Fähigkeiten und der Gesprächsführung im Allgemeinen. Die Möglichkeit, Gespräche zu führen und zu strukturieren, die Gesprächsdauer zu managen sowie offene und geschlossene Fragestile auszuprobieren, wird optimal gefördert. Der Bot hilft Studierenden, die Fähigkeit zur präzisen Diagnose, Datenanalyse und das klinische Denken zu verbessern. Studierende schätzen die Möglichkeit, fehlerfrei und angstfrei zu üben. Das fördert die Sicherheit und Selbstreflexion. Weniger gut lassen sich bisher die nonverbale Kommunikation, emotionale Reaktionen und komplexere, weniger vorhersagbare psychosoziale Aspekte trainieren, die stark von der menschlichen Interaktion abhängen.
Wie reagieren Studierende auf das Arbeiten mit dem Bot? Gibt es Rückmeldungen zur Motivation oder zum Lernerfolg?
Die Reaktionen der Studierenden auf das Arbeiten mit dem Bot sind äußerst positiv. Erste Studienergebnisse zeigen, dass das Antwortverhalten der KI ziemlich präzise und plausibel ist. Die Studierenden bewerten die Simulationen als realistisch und berichten von einer insgesamt hohen Zufriedenheit hinsichtlich der Anwendbarkeit des Übungstools. Die sprachlichen Fähigkeiten und die Präzision der Antworten des Chatbots werden durchweg positiv bewertet. Dies deutet auf eine hohe Motivation und ein positives Lernerlebnis hin. Die erwähnten Ergebnisse der ersten Evaluation machen deutlich, dass sich rund 79 Prozent der Studierenden für KI-basierte Trainingssettings aussprechen, während lediglich etwa 20 Prozent weiterhin traditionelle Methoden wie das Üben mit realen Patient:innen oder Schauspieler:innen favorisieren.
Wie wird der Bot konkret in das berufsbegleitende Studium eingebunden? Gibt es bestimmte Module oder Szenarien?
Der Bot ist als digitaler Lehrassistent konzipiert und wird über die hauseigene "Guided Conversation Designer (GCD)"-Plattform der IU implementiert. Von dort aus ist er für die Studierenden über den universitätsinternen KI-Studienassistenten zugänglich. Aktuell wurde der Bot ausschließlich im Rahmen freiwilliger Testungen eingesetzt, bei denen anamnesegestützte Gespräche simuliert wurden. Ein Beispiel hierfür ist der virtuelle Patient "Karl von Hausen", der nach einem Fahrradunfall eine Gehirnblutung mit Begleitsymptomen wie Sprach- und Schluckstörungen, Halbseitenlähmung sowie weiteren Vorerkrankungen aufweist. Die Studierenden übernehmen dabei die Rolle von medizinischen Fachkräften, um eine umfassende Einschätzung der Gesundheitssituation des Patienten zu erlangen. Das Szenario wurde so konzipiert, dass es interprofessionelles Lernen fördert und eine breite Zielgruppe von Studierenden aus verschiedenen Gesundheitsstudiengängen anspricht. Die Prompts für diese Szenarien sind sehr detailliert und umfassend gestaltet, um dem Sprachmodell alle notwendigen Hintergrundinformationen bereitzustellen und ein konsistentes Antwortverhalten zu gewährleisten.
Welche Rolle spielt das automatisierte Feedback für die Reflexion und Weiterentwicklung der Lernenden?
Das automatisierte Feedback spielt eine zentrale Rolle für die Reflexion und Weiterentwicklung der Lernenden. Obwohl wir die detaillierte Auswertung dazu noch abschließen, ist es ein wesentlicher Bestandteil der Lernarchitektur. Grundsätzlich ermöglichen KI-Systeme wie unser Bot, den Lernfortschritt von Studierenden zu verfolgen und ihnen personalisierte Anleitung und Feedback zu geben. Die Integration von individualisiertem Anamnese-Feedback direkt vom Chatbot an die Studierenden ist der nächste Entwicklungsschritt, um gezielte Einblicke in ihre Leistung zu ermöglichen und ihre Lernerfahrung weiter zu verbessern. Ein solcher Rückmeldemechanismus ist entscheidend, um den Prompt kontinuierlich zu reevaluieren und zu optimieren, da er Schwachstellen identifizieren und die Effektivität sowie Nutzererfahrung kontinuierlich verbessern kann. Für die Zukunft ist es auch entscheidend, dass Lehrende und Studierende lernen, die Antworten der KI kritisch zu reflektieren und zu kontextualisieren, insbesondere im Hinblick auf mögliche KI-Halluzinationen oder Fehlinformationen.
Wie verändert sich durch solche digitalen Tools die Rolle von Lehrenden in der Pflegeausbildung?
Die Rolle der Lehrenden wandelt sich durch solche digitalen Tools von reinen Wissensvermittler:innen hin zu Begleiter:innen und Kontextualisierer:innen des Lernprozesses. In unserem Projekt sind Lehrende aktiv an der Entwicklung und Validierung der KI-Modelle beteiligt, um die medizinische Genauigkeit und den pädagogischen Wert sicherzustellen. Ihre Aufgabe wird es sein, die Studierenden anzuleiten, die Antworten der virtuellen Patient:innen kritisch zu reflektieren und einzuordnen, mögliche Risiken wie KI-Halluzinationen zu erkennen und technologische Kompetenzen zu vermitteln. Die Tools ermöglichen es den Lehrenden zudem, den Fortschritt der Studierenden besser zu verfolgen und personalisierte Anleitungen und Feedback zu geben. Die Rolle der Lehrenden wird also komplexer und vielschichtiger, da sie nicht nur Fachwissen vermitteln, sondern auch die digitale Kompetenz und das kritische Denken der Studierenden im Kontext neuer Technologien fördern müssen.
Wo sehen Sie die größten Potenziale von KI in der pflegerischen Lehre – und wo liegen aus Ihrer Sicht klare Grenzen?
Künstliche Intelligenz bietet in der pflegerischen Lehre großes Potenzial, indem sie flexibles, skalierbares und kosteneffizientes Training grundlegender Kompetenzen ermöglicht. Virtuelle Patient:innen erlauben das Üben verschiedener klinischer Szenarien unabhängig von Zeit und Ort und fördern digitale Kompetenzen sowie selbstgesteuertes Lernen. Dennoch stößt KI aktuell noch an Grenzen, insbesondere bei der Vermittlung von Empathie und nonverbaler Kommunikation. Auch ethische und rechtliche Fragen, etwa zum Datenschutz und zur Haftung, sind noch nicht abschließend geklärt. Der direkte Kontakt mit Patient:innen bleibt daher unersetzlich, sodass KI-Tools vor allem als ergänzende Unterstützung dienen sollten.
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit KI-gestützte Lernformate sinnvoll und nachhaltig in der Ausbildung verankert werden können?
Für die nachhaltige Integration KI-gestützter Lernformate im Studium oder Aus-, Fort- und Weiterbildung sind verschiedene Voraussetzungen notwendig. Zentrale Grundlage ist ein detaillierter und präziser Prompt, der dem Sprachmodell alle relevanten Informationen liefert, um konsistente Antworten zu ermöglichen. Dieser Prompt muss systematisch getestet und kontinuierlich optimiert werden, um die Zuverlässigkeit in unterschiedlichen Anwendungsszenarien zu gewährleisten. Die regelmäßige Überprüfung der generierten Antworten durch qualifiziertes Fachpersonal bleibt unerlässlich, insbesondere bei komplexen medizinischen Inhalten, da Chatbots nicht als letzte Entscheidungsinstanz fungieren dürfen. Transparenz über die Funktionsweise und mögliche Schwächen der KI sowie eine klare Kommunikation über den Status als Lernwerkzeug sind ebenso erforderlich. Ergänzend müssen ethische und rechtliche Rahmenbedingungen, insbesondere hinsichtlich des erwähnten Datenschutzes und der Haftung, geklärt werden. Schließlich sind die Einbindung von Nutzerfeedback und die Förderung digitaler Kompetenzen bei Lehrenden und Lernenden entscheidend für den erfolgreichen Einsatz solcher Lernformate.
Wie könnte sich der Einsatz solcher Tools in der Pflegepraxis weiterentwickeln – etwa im Rahmen von Fort- und Weiterbildungen?
Der Einsatz digitaler Tools bietet großes Potenzial für die Weiterentwicklung der Pflegepraxis, insbesondere in der Fort- und Weiterbildung. Vorteile wie Zugänglichkeit und Flexibilität ermöglichen es Pflegefachkräften, ihre Kompetenzen bedarfsgerecht und unabhängig von Zeit und Ort zu vertiefen. Durch spezialisierte Simulationen können auch seltene oder komplexe Situationen realitätsnah trainiert werden, was die Patient:innensicherheit erhöht. Zudem trägt der Einsatz von KI-gestützten Anwendungen zur Standardisierung und Qualitätssteigerung der Trainingsinhalte bei. Erste Anwendungen, wie Chatbots zur Gesundheitsinformation oder Patient:innenschulung, sind bereits etabliert. Künftig könnten durch die Integration von Sprach- und visuellen Elementen noch realistischere und interaktivere Lernumgebungen geschaffen werden.
Was wünschen Sie sich von Bildungseinrichtungen, Trägern und der Politik, um digitale Innovationen wie diesen Bot flächendeckend nutzbar zu machen?
Um digitale Innovationen wie den Anamnese-Bot flächendeckend nutzbar zu machen, ist eine enge und proaktive Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure erforderlich. Bildungseinrichtungen sollten neue KI-Konzepte mutig in ihre Lehrpläne integrieren, die notwendige IT-Infrastruktur bereitstellen und ihre Curricula kontinuierlich anpassen, um digitale Kompetenzen und einen reflektierten Umgang mit KI zu vermitteln. Träger wie Klinikbetreiber und Ausbildungsstätten sind gefordert, den Mehrwert KI-gestützter Trainings für die Aus- und Weiterbildung ihrer Fachkräfte anzuerkennen, entsprechende Ressourcen bereitzustellen und Pilotprojekte zu ermöglichen, um Best-Practice-Modelle zu identifizieren. Die Politik wiederum muss rasch geeignete regulatorische Rahmenbedingungen schaffen, die den sicheren, ethischen und rechtlich einwandfreien Einsatz von KI gewährleisten, Forschung und Entwicklung fördern sowie Bildungseinrichtungen finanziell bei der digitalen Transformation unterstützen. Nur mit einer abgestimmten Zusammenarbeit und einem gemeinsamen Verständnis der Chancen und Herausforderungen von KI ist deren Potenzial für eine zukunftsfähige Ausbildung im Gesundheitssystem voll auszuschöpfen.