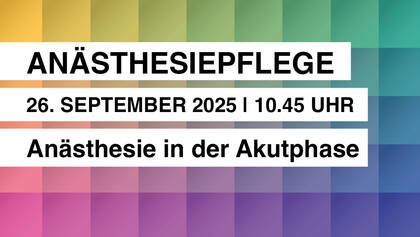Wer den Begriff „Green Care" zum ersten Mal hört, stellt sich mit Sicherheit die Frage, was damit wohl gemeint sein könnte. Folgende acht Fragen und Antworten sollen dabei helfen, sich im Dschungel der Begrifflichkeiten und Wirrwarr der Definitionen zurechtzufinden.
Wie, wann und warum ist der Begriff „Green Care" entstanden?
Initiativen wie tiergestützte Therapie und Pädagogik, Gartentherapie oder auch soziale Landwirtschaft sind nicht neu und gibt es in einigen europäischen Ländern schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten. Seit den 1980ern wurden auch vermehrt wissenschaftliche Studien zu diesen und ähnlichen praktischen Ansätzen betrieben. Rund um die Jahrtausendwende gab es dann einige internationale Konferenzen und Projekte, bei denen durch die Beteiligten angeregt wurde, sich basierend auf gemeinsamen Interessen und Zukunftsvorstellungen zusammenzuschließen. Denn obwohl die inhaltlichen und konzeptionellen Ansätze von tiergestützter Therapie, Gartentherapie, sozialer Landwirtschaft und Co. sehr unterschiedlich sein können, stoßen sie bei ihrer praktischen und wissenschaftlichen Umsetzung dennoch oftmals vor vergleichbare Probleme, haben sie mit denselben Vorurteilen zu kämpfen und lassen sie sich durch gemeinsame Grundmotive und Zielsetzungen vereinen. Im Zuge dieser Überlegungen wurde der Begriff „Green Care" Anfang des 21. Jahrhunderts zunächst als rein theoretisches Modell aus der Taufe gehoben, um praktischen und wissenschaftlichen Initiativen, welche Tiere, Pflanzen und Natur als Basis haben, ein gemeinsames und starkes Standbein in Öffentlichkeit, Politik und Wirtschaft zu verschaffen.
Muss es immer Englisch sein?
Da diese zuvor erwähnten Treffen im Rahmen europaweiter Konferenzen stattfanden, einigten sich die Beteiligten mit „Green Care" zunächst auf einen anglikanischen Begriff. In einem zweiten Schritt wurde diskutiert, ob es sinnvoll wäre, in jedem Land Übersetzungen zu etablieren, oder das englische Wort selbst zu verwenden. Schlussendlich verständigte man sich auf die letztere Option, da davon ausgegangen wurde, dass das Modell von „Green Care" ohnedies in jedem Land neu etabliert, erklärt und implementiert werden müsse. Und da könne dann auch gleich in jedem Land derselben Begriff eingesetzt werden, um einem babylonischen Sprachenchaos mit unterschiedlichen Definitionen und Wortverständnissen zuvorzukommen. Außerdem würde es der internationalen Verständigung dienen, wenn Personen aus unterschiedlichen Ländern bei der Erwähnung des Wortes „Green Care" gleich wüssten, wovon die Rede ist.
Was bedeutet „Green Care"?
„Green Care" ist ein Sammelbegriff, der viele verschiedene Initiativen unter sich vereint. Diese Initiativen können individuelle Ziele verfolgen, sich an unterschiedliche Zielgruppen richten und ihre eigenen Methoden beinhalten. Dennoch teilen sie einige entscheidende Kriterien miteinander:
a) Sie alle arbeiten mit Elementen der Natur. Diese Elemente können entweder belebt sein (wie Pflanzen und Tiere), oder unbelebt (etwa Wasser oder Steine). Sie können einzeln eingesetzt werden (EIN Tier, EINE Pflanze) oder in Form von Settings (als Garten, Park, Wald, landwirtschaftlicher Betrieb,etc).
b) Sie alle haben dasselbe Grundmotiv: Nämlich die Förderung der körperlichen und/oder mentalen Gesundheit einer Person, beziehungsweise die Verbesserung ihrer sozialen Bedingungen und/oder ihrer pädagogischen Entwicklung. In Situationen, bei denen keine Verbesserung erreicht werden kann, soll zumindest der Erhalt des Ist-Zustandes gewährleistet werden.
c) Ihnen allen liegen mehr oder weniger strukturierte Programme zugrunde, mit vordefinierten Zielsetzungen, die dann auch dokumentiert und deren Erreichung evaluiert werden. Das jeweilige Ziel (etwa eine Art der Therapie/Pflege/Rehabilitation, etwas zu lernen oder sich persönlich weiter zu entwickeln) muss bewusst angestrebt werden.
Welche Anwendung findet „Green Care" in Praxis und Wissenschaft?
In Europa gibt es einige wenige bekannte, und viele lokal begrenzte und daher eher unbekannte „Green Care"-Initiativen. Zu den bekanntesten und bis heute wissenschaftlich am besten untersuchten zählen etwa die tiergestützte Therapie, die Gartentherapie und die soziale Landwirtschaft. Obwohl diese Initiativen bereits seit vielen Jahren im Einsatz und über weite Teile Europas verbreitet sind, mangelt es auch heute noch an klaren Definitionen und Terminologien. Bedingt durch Übersetzungen in jeweilige Landessprachen und unterschiedliche geschichtliche Entwicklungen in den einzelnen Ländern findet man diese Initiativen oftmals unter verschiedenen Namen und in unterschiedlichen Ausprägungen. Daneben gibt es noch eine lange Liste kleinerer „Green Care" Bereiche, welche lokal jedoch oftmals große Bedeutung erfahren. Dazu zählen unter anderem die Outdoor- Pädagogik, Abenteuer- und Naturtherapie, Wald- und Forsttherapie, green exercise, oder healing gardens (heilende Gärten), um nur einige zu nennen
Welche Zielgruppen werden von „Green Care" angesprochen?
Aufgrund seiner Bandbreite richtet sich „Green Care" an unterschiedlichste Zielgruppen mit ganz individuellen Bedürfnissen und Wünschen. Kinder und Jugendliche können ebenso angesprochen werden wie erwachsene und ältere Menschen. Manche Personen mögen eine medizinische Indikation haben, oder besondere körperliche oder geistige Bedürfnisse, andere nicht. Der Kreativität der Anbieter sind hier nur wenige Grenzen gesetzt; wichtig sind vielmehr die Eignung und Qualifikation des Angebotes, sowie die Einhaltung bestimmter Sicherheitsstandards.
Wo liegen die Grenzen von „Green Care"?
„Green Care" ist kein Allheilmittel und soll auch nicht als Zauberei dargestellt werden. Die Hilfe und Förderung, die ein Kind durch einen Hund, oder eine Person mit Burn-out durch ihre Arbeit auf einem landwirtschaftlichen Betrieb erfahren können, sind zwar durchaus wunderbar, aber kein Wunder. Ihr zugrunde liegt eine fundierte Aus- und Weiterbildung der Anbieter, die Eignung der gewählten „Green Care"-Initiative, welche individuell auf die Bedürfnisse und Zielsetzungen der Klienten oder Patienten abgestimmt wird, sowie die Einhaltung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards. All diese Bestandteile kommen in Form eines mehr oder weniger festgelegten Programms zur Geltung und werden laufend auf ihren Erfolg hin dokumentiert und evaluiert. „Green Care" eignet sich somit auch nicht für jeden. Mögliche Ausschlusskriterien können unter anderem Allergien, kulturell und erfahrungsbedingte Vorlieben und Interessen, sowie die jeweiligen Indikationen und Zielsetzungen sein. Eine Person mit Heuschnupfen wird sich zum Beispiel auf einem landwirtschaftlichen betrieb weniger wohl fühlen als ein alternder Mensch, der schon als Kind oft auf einem Bauernhof war, und der durch diese Aufenthalte an seine Jugend erinnert wird.
Was ist neu an „Green Care"?
Eigentlich gar nichts. Die Bestandteile und zugrunde liegenden Motive – wie etwa die Erkenntnis, dass Bewegung an der frischen Luft gesund ist, oder dass positive Interaktionen mit Tieren die Stimmung verbessern können - sind teilweise schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden bekannt und in Anwendung. Dennoch bietet das theoretisch-wissenschaftliche Modell von „Green Care" zum ersten Mal die Möglichkeit, all diese einzelnen Bestandteile, Motive und Ziele zusammenzufassen und unter einem gemeinsamen Schirm zu vereinen. Bei dem Konzept von „Green Care" geht es weniger darum, etwas Neues zu erfinden, sondern darum, eine gemeinsame Plattform zu schaffen, die das Wiederentdecken und Weiterentwickeln alten Wissens rund um die heilende und wohltuende Wirkung von Tieren, Pflanzen und Natur fördern und vereinfachen soll.
Welches Auftreten hat „Green Care" zurzeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz?
In Deutschland haben der Begriff und die Inhalte von „Green Care" bisher noch wenig Einzug gehalten. Einzelne „Green Care"-Bereiche, wie die Gartentherapie, die tiergestützte Therapie und auch die soziale Landwirtschaft erfreuen sich zwar einer nationalen Verbreitung, eine Zusammenführung unter dem Sammelbegriff von „Green Care", wie in diesem Beitrag umschrieben, hat bisher jedoch noch kaum stattgefunden. Gezielte und bewusste Informationstätigkeiten werden in den kommenden Jahren hier viel bewirken können. In Österreich ist es durch eine Reihe wissenschaftlicher und praktischer Projekte und Initiativnehmer mittlerweile gelungen, den Begriff „Green Care" von einem rein theoretischen Modell in Richtung einer praktischen Umsetzung zu transportieren. Diese Entwicklung begann rund um das Jahr 2010 und hat noch einen weiten Weg vor sich. Es ist jedoch sehr spannend zu beobachten, wie ein zunächst rein theoretisches Konzept seinen Weg in die Praxis findet. Spricht man in der Schweiz von „Green Care", erkennt man, dass viele Personen diesen Begriff mit dem der sozialen Landwirtschaft gleichsetzen. Die soziale Landwirtschaft ist jedoch ein einzelner „Green Care" Bereich, wie etwa die tiergestützte Therapie oder die Gartentherapie auch. Man versteht darunter all jene Initiativen, die auf landwirtschaftlichen Betrieben stattfinden, wie etwa Therapie/Rehabilitation/Pflege (care farming) oder Lernen/Erziehung/Ausbildung (Bauernhofpädagogik). Diese Verwirrung ist nicht nur auf die Schweiz beschränkt, sondern findet man auch in vielen anderen europäischen Ländern. Ursache hierfür sind individuelle geschichtliche Entwicklungen in den einzelnen Ländern.
Dieser Artikel erschien erstmals in der Zeitschrift "Green Care" Ausgabe 1/2014. Wir danken der Autorin und den Verlag Hans Huber für die Genehmigung der Zweitveröffentlichung.