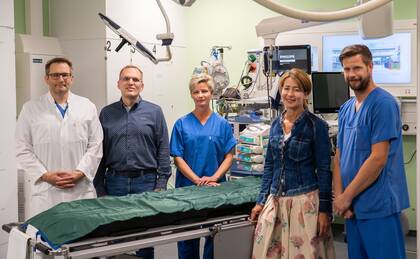Mehrere führende Fachgesellschaften aus Notfall- und Intensivmedizin haben eine gemeinsame Stellungnahme zu Abbruch und Verzicht von Reanimationsmaßnahmen veröffentlicht. Das sogenannte Advisory Statement fasst aktuelle Erkenntnisse, klinische Erfahrungen und ethische Grundsätze zusammen und formuliert fünf zentrale Thesen, die Behandlerinnen und Behandlern Orientierung in kritischen Situationen geben sollen, in denen über Reanimationsmaßnahmen entschieden werden muss.
Prognose und demografische Entwicklung
Die Überlebenschancen nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand sind trotz technischer Fortschritte weiterhin gering. Nach Angaben des Deutschen Reanimationsregisters überlebten im Jahr 2024 lediglich 7,9 Prozent der reanimierten Patientinnen und Patienten mit gutem neurologischem Ergebnis (CPC 1–2), weitere 1 Prozent mit schwerer Beeinträchtigung (CPC 3–4). Zugleich steigt der Anteil hochbetagter Betroffener: 32,6 Prozent der Reanimierten waren 2024 über 80 Jahre alt, gegenüber 27,7 Prozent im Jahr 2014. Auch die Häufigkeit von Kammerflimmern als initialem Rhythmus nimmt ab und lag zuletzt bei rund 21,5 Prozent. Diese Entwicklungen unterstreichen die Bedeutung realistischer und patientenorientierter Therapieentscheidungen.
Die fünf Kernthesen der Stellungnahme
1. Reanimation braucht ein Therapieziel. Maßnahmen dürfen nicht Selbstzweck sein. Sie sind nur indiziert, wenn ein realistisches Therapieziel erreichbar ist. Kriterien wie Alter, Komorbidität, Frailty, fehlende Laienreanimation, Asystolie oder ausbleibender Rückkehr eines spontanen Kreislaufs (Return of Spontaneous Circulation, ROSC) können die Entscheidung zum Abbruch stützen. Bei fehlender Aussicht auf Erfolg ist eine Therapiezieländerung hin zur Palliation geboten – klar kommuniziert und dokumentiert.
2. Patientenwillen frühestmöglich berücksichtigen. Liegt eine Patientenverfügung, ein ACP-Dokument oder glaubhafte Ablehnung vor, sind Reanimationsmaßnahmen sofort zu beenden. Dies ist ethisch und rechtlich geboten und keine Unterlassung, sondern Umsetzung des Patientenwillens.
3. Realistische Aufklärung über Prognose und Folgen. Patientinnen und Patienten sowie Angehörige überschätzen häufig die Erfolgsaussichten. Gespräche über Therapiebegrenzungen sollten frühzeitig erfolgen, insbesondere bei lebenslimitierenden Erkrankungen. Studien zeigen: Fundierte Aufklärung beeinflusst Entscheidungen deutlich und kann unnötige Reanimationsversuche verhindern.
4. Wünsche verlässlich dokumentieren. Strukturierte Gesprächsprozesse und rechtssichere Dokumente sind essenziell, um im Notfall klare Handlungsgrundlagen zu haben. Standardisierte Formulare wie der DIVI-Bogen zur Therapiebegrenzung oder regionale Notfallausweise können helfen.
5. Der Tod gehört zum Leben. Nicht jede Reanimation ist sinnvoll oder gewollt. In solchen Fällen muss der Fokus auf Palliativversorgung und würdevolles Sterben gelegt werden. Alle Berufsgruppen benötigen dafür palliativmedizinisches Basiswissen und Kommunikationskompetenz, um Angehörige sicher und empathisch begleiten zu können.
Pflegespezifische Inhalte
Die Stellungnahme hebt zwei Punkte hervor, die für Pflegefachpersonen besonders relevant sind:
Kommunikation mit Angehörigen. Damit Therapiezielgespräche auch unter Zeitdruck verlässlich geführt werden können, müssen Notärztinnen und Notärzte, Ärztinnen und Ärzte, Pflegefachpersonen und Rettungsdienstfachpersonal besser in der Gesprächsführung geschult werden.
Palliativmedizinisches Basiswissen. Alle Berufsgruppen in der Notfallversorgung – einschließlich der Pflege – benötigen Grundkenntnisse in Palliativversorgung, um den Fokus bei aussichtslosen Situationen von der Lebensrettung hin zur Begleitung in Würde zu verlagern.
Diese Kompetenzen sollen helfen, Angehörige empathisch zu begleiten, unnötige Maßnahmen zu vermeiden und moralische Belastungen für das Behandlungsteam zu reduzieren.
Ausblick: Mehr Schulungen und klare Vorgaben nötig
Die Fachgesellschaften betonen: Ziel ist eine Behandlung, die Überlebenschancen realistisch einschätzt und dem Patientenwillen entspricht. Gleichzeitig müssen Maßnahmen wie Telefonreanimation, Ersthelfersysteme und Schulungen weiter ausgebaut werden, um die Überlebensrate insgesamt zu steigern. Strukturierte Entscheidungsprozesse und frühzeitige Einbindung des Patientenwillens sollen Über- und Untertherapie vermeiden und Behandelnde vor moralischer Belastung schützen.