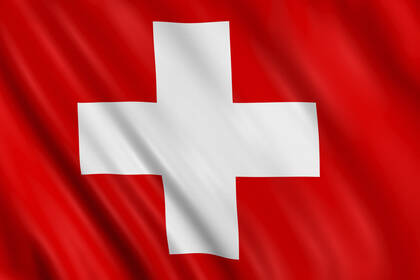Ambulante Pflegedienste – in der Schweiz Spitexorganisationen genannt – können ab dem 1. Juli 2024 Abklärungs-, Beratungs-, Koordinations- und Grundpflegeleistungen ohne ärztliche Anordnung oder ärztlichen Auftrag zulasten der Obligatorischen Krankenpflegeversicherung erbringen und abrechnen. Dies ist ein Bestandteil der ersten Umsetzungsetappe der Eidgenössischen Volksinitiative „Für eine starke Pflege (Pflegeinitiative)“, die am 28. November 2021 angenommen wurde und nun in zwei Etappen umgesetzt werden soll. Die erste Etappe beinhaltet die direkte Abrechnung von bestimmten Pflegeleistungen und eine „Ausbildungsoffensive“, die vor allem zusätzliche Ausbildungsstellen zum Ziel hat.
Vorreiter der Pflegeinitiative war Nationalrat Lorenz Joder, der mit der „Initiative Joder“ bereits 2011 die Position und Arbeitsbedingungen der Pflegefachpersonen in der Schweiz zu stärken wollte. Ein zentrales Anliegen dieser Initiative war die Anerkennung der Pflege als eigenständiger und wesentlicher Bestandteil des Gesundheitssystems – unabhängig von ärztlichen Anordnungen.
Mehr Autonomie und Verantwortung für Pflegefachpersonen
Durch die Initiative wurde der Grundstein für aktuellen Gesetzesänderungen gelegt, die eine größere Autonomie und Verantwortung für Pflegefachpersonen vorsehen. Nach nunmehr 13 Jahren werden nun Teilerfolge erzielt. So wurde im Bundesgesetz über die Krankenversicherungen bei Artikel 35 Absatz 2 Pflegefachpersonen hinzugefügt. Das bedeutet: Alle zugelassenen Pflegefachpersonen nach Artikel 49 KVV (Verordnung über die Krankenversicherung) und Organisationen der Krankenpflege und Hilfe zu Hause nach Artikel 51 dürfen bei Inkrafttreten der angepassten GesetzgebungLeistungen ohne ärztliche Verordnung in Rechnung stellen.
Spätestens nach neun Monaten wird ein Reassessment durchgeführt. Spätestens nach 27 Monaten erfolgt ein Bericht an die zuständige Hausärztin oder den zuständigen Hausarzt. Danach beginnt der 27-Monate-Zyklus erneut. Dieser Bericht soll den Informationsfluss zwischen der Spitexorganisation und der Hausärztin oder dem Hausarzt sichern. Eine Kontrolle der Berichterstattung seitens Krankenversicherung ist nicht vorgesehen.
Zur Art und Form des Berichtes gibt es keine Vorgaben. Idealerweise können sie aus den Daten der Pflegedokumentation zusammengefasst und versendet werden. Die Softwareanbieter sind hier aufgefordert diesbezüglich Anpassungen vorzunehmen.
Maßnahmen der Untersuchung und Behandlung – zum Beispiel Medikation, Injektionen und Verbandswechsel – müssen hingegen weiterhin auf ärztliche Anordnung oder im ärztlichen Auftrag erfolgen – da diese Leistungen, so die Auffassung der Gesetzgebung – eng mit der ärztlichen Behandlung verknüpft sind.
Auf Wunsch der Versicherungen soll künftig auf den Rechnungen nachgewiesen werden können, ob die Pflegeleistungen mit oder ohne ärztlichem Auftrag erbracht wurden.
Schritt in die richtige Richtung
Die Stärkung der Pflege durch die selbständige Abrechnung ist eine Abbildung in der Gesetzgebung der heute zumeist schon gelebten Realität. Pflegefachpersonen können den Pflegebedarf am besten einschätzen. Die ärztliche Verordnung war in vielerlei Hinsicht bürokratischer Mehraufwand ohne großen Nutzen. Die neue Gesetzgebung vereinfacht die bürokratischen Prozesse – ohne in jedem Fall die Schlaufe zum Hausarzt und zurück zu erzwingen. Die gesetzliche Novelle ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Nun bleibt zu hoffen, dass die zweite Umsetzungsetappe zeitnah folgen wird. Sie beinhaltet im Kern bessere Arbeitsbedingungen für Pflegefachpersonen.