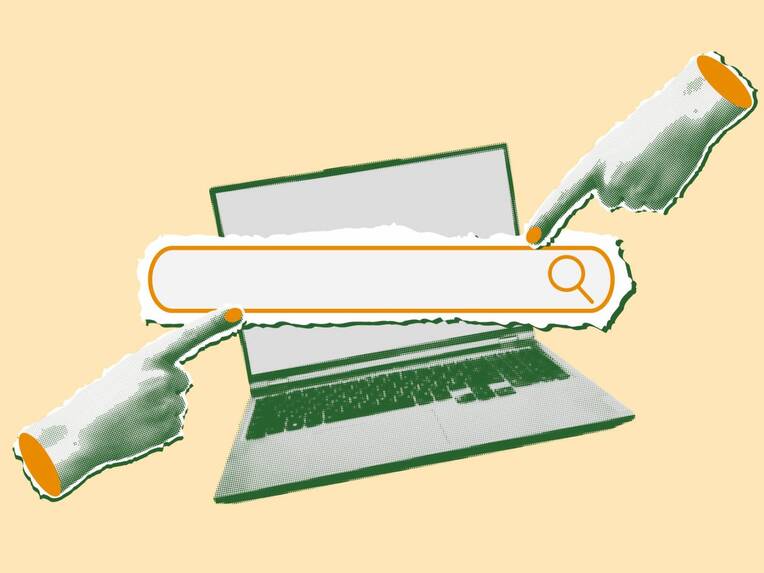Ein aktuelles Forschungsprojekt untersucht die Auswirkungen des „DigitalPakts Schule“ auf Pflegeschulen.
Mit dem DigitalPakt Schule (DPS) will die Bundesregierung die digitale Infrastruktur in Schulen verbessern. Wie werden die Fördermöglichkeiten von Pflegeschulen im Hinblick auf Anschaffungen digitaler Technologien (Infrastruktur), auf deren pädagogisch-didaktische Einbindung in Lehr- und Lernprozesse (Gestaltung) sowie auf Verantwortungsstrukturen, Koordinationsprozesse und -praktiken der digitalen Transformation von Pflegeschulen (Governance) genutzt? Diese Frage ist Gegenstand des vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) beauftragten Forschungsprojekts „Digitalisierungsprozesse der beruflichen Ausbildung in Pflegeschulen (DibAP)“ des Instituts Arbeit und Technik (IAT) an der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen und der Abteilung Pflegewissenschaft der Universität Osnabrück. Die erste Befragungswelle im Sommer 2023 adressierte Pflegeschulen in privater Trägerschaft bundesweit sowie Pflegeschulen aller Trägertypen in Nordrhein-Westfalen. 264 Pflegeschulen füllten den Online-Fragebogen vollständig aus und wurden in die Auswertung eingeschlossen.
Insgesamt wurde deutlich, dass der DPS als Instrument für die digitale Transformation von Pflegeschulen rege genutzt wurde. Allerdings zeigten sich große Unterschiede, etwa im Hinblick auf die Pflegespezifität der Technologien sowie die Verfügbarkeit strukturierter Qualifikationsangebote für Lehrende. Für die Bewilligungspraxis deutete sich der Bedarf an einer pflegeausbildungsspezifischeren Weiterentwicklung der Förderkulisse an. Eine ausführlichere Publikation zu den hier skizzierten Zwischenergebnissen ist in Vorbereitung.
Pflegespezifität. Die von den Pflegeschulen über den DPS „ganz“ oder „teilweise“ angeschaffte digitale Ausstattung ist häufig wenig pflegespezifisch: Zwei Drittel der befragten Schulen (66,3 %) haben Anzeige- und Interaktionsgeräte wie digitale Tafeln, Smartboards oder Beamer angeschafft. Die überwiegende Mehrheit der Schulen (93,9 %) verfügte zum Erhebungszeitpunkt über PC-Arbeitsplätze für Lehrende, weniger als ein Drittel (28,8 %) haben diese über den DPS finanziert. Weitere über den DPS angeschaffte allgemeine Ausstattungen waren Kameras (43,6 %) und Mikrofone (36,0 %). Weniger als ein Drittel (29,2 %) haben eine digitale Pflegepuppe und 15,5 % ein digital gestütztes Skills Lab über den DPS angeschafft. 41,3 % der Schulen hatten Anschaffungen getätigt, die Interaktionsarbeit unterstützen, etwa Virtual-Reality-Brillen. 29,5 % haben Anschaffungen getätigt, die körpernahes Arbeiten unterstützen, beispielsweise digitale Pflegepuppen. Lediglich 15,9 % der Schulen berichteten über Anschaffungen, die begrenzte Standardisierbarkeit im Pflegeprozess erfahrbar macht, und nur ein sehr geringer Anteil von Pflegeschulen (1,5 %) berichtet über Anschaffungen, die Arbeit in komplexen Pflegearrangements adressierte, etwa Skills Labs oder Serious Games.
Qualifizierungsangebote für Lehrende. Für die Einbindung digitaler Technologien in den Unterricht ist es erforderlich, dass Lehrende über pädagogische und didaktische Kompetenzen verfügen oder die Möglichkeit haben, sich diese durch Fort- oder Weiterbildung anzueignen. Nach Einschätzung der befragten Schulen sind Lehrende eher sicher im Umgang mit digitalen Alltagstechnologien, wie mobilen Endgeräten (89,5 %), Interaktions- und Anzeigegeräten (82,3 %) oder Softwareprogrammen (81,5 %).
Im Vergleich dazu sind an weniger als zwei Dritteln der befragten Schulen (60,7 %) die Lehrenden sicher im Umgang mit pflegespezifischen Arbeitsgeräten wie digitalen Pflegepuppen oder digitalen Messgeräten. An mehr als zwei Dritteln der Schulen (69,1 %) wurden die durch den DPS angeschafften Technologien „immer“ oder „häufig“ für Fort- und Weiterbildung der Lehrenden genutzt. Doch nur an etwa einem Drittel der befragten Schulen (36,7 %) nehmen alle Lehrenden Fortbildungen zu digitalen Inhalten wahr. An einem weiteren Viertel der Schulen (26,1 %) nimmt mehr als die Hälfte der Lehrenden an entsprechenden Fortbildungen teil. An knapp zwei Dritteln (63,7 %) der Schulen, an denen Lehrende an Fortbildungen zu digitalen Inhalten teilnehmen, haben diese auch einen konkreten Bezug zur Pflegeausbildung.
Bewilligungspraxis. Pflegeschulen müssen ihre Anträge zur Förderung von Technologien an die jeweils zuständige(n) Stelle(n) in ihrem Bundesland richten. In der Bewilligungspraxis zeigten sich Unterschiede hinsichtlich der beantragten und geförderten Anschaffungen. So wurden etwa bei der Frage nach gewünschten Ausstattungen, die bisher nicht über den DPS beschafft werden konnten, am häufigsten pflegespezifische Technologien wie Simulationstechnologien/Skills Labs (55 Nennungen) und (digitale) Pflegepuppen (42 Nennungen) genannt. Die Gründe für die Nichtanschaffung dieser gewünschten Ausstattungen werden im Projekt ebenfalls untersucht. Erste Hinweise auf Gründe fanden sich in den Freitextantworten. So wurde etwa Kritik dahingehend geäußert, dass der DPS den Bedarf kleinerer Pflegefachschulen nicht hinreichend abbilde oder dass nicht alle beantragten und als sinnvoll für die Pflegeausbildung beurteilten Technologien bewilligt werden. In diesem Sinne wurde auch der Wunsch nach einer Ausweitung oder pflegeausbildungsspezifischen Weiterentwicklung der Förderkulisse geäußert.
Ausblick. Derzeit läuft die Auswertung der zweiten standardisierten Befragung von Pflegeschulen und der qualitativen Interviews, die mit Lehrenden, Schulleitungen und Mitarbeitenden der Bewilligungsbehörden geführt wurden. Zeitgleich werden Fokusgruppeninterviews mit unterschiedlichen Akteuren der Pflegeausbildung vorbereitet.
Eine Weiterführung des DPS unter Berücksichtigung der spezifischen Bedarfe von Pflegeschulen bietet die Chance, die Möglichkeiten der Digitalisierung für die Pflegeausbildung gewinnbringend zu nutzen und auf aktuelle Herausforderungen in der pflegeberuflichen Ausbildung zu reagieren.
Mitte 2025 werden die abschließenden Ergebnisse des Projekts DibAP vorliegen.