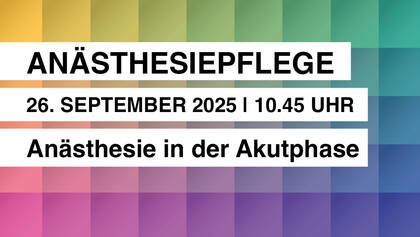Jutta Rothfuß arbeitet als Pflegefachperson für Onkologie und Palliativmedizin am Universitätsklinikum Tübingen. Wir sprachen mit ihr, warum sie dort einen „Hoffnungsweg“ ins Leben gerufen hat, wie hoffnungsfördernde Pflege – egal in welchem Setting – gelingen kann und warum sich Pflegende auch mit ihrer eigenen Spiritualität auseinandersetzen sollten.
Frau Rothfuß, wie ist die Idee für den "Hoffnungsweg" am Universitätsklinikum Tübingen entstanden?
Als Krankenschwester in der Onkologie und Palliativmedizin war es mir ein Anliegen, ein Projekt zu entwickeln, das die pflegerische Handlungskompetenz stärkt. Ich suchte nach einem Thema, bei dem Pflegende selbstständig und ohne ärztliche Anordnung wohltuende Maßnahmen für Krebspatienten vornehmen können. Dabei bin ich über die Pflegewissenschaftlerin Angelika Zegelin auf das Thema Hoffnung gestoßen. Insbesondere ihr Satz "Pflegende, denen es nicht gelingt, Hoffnung zu erhalten oder entstehen zu lassen, werden diesem Beruf nicht gerecht" inspirierte mich dazu, meine Facharbeit im Rahmen der Weiterbildung Onkologie zum Thema "Hoffnung vermitteln in der onkologischen Pflege – eine Kompetenz zur Gesundheitsförderung" zu schreiben.
Der Hoffnungsweg ist ein Erlebnisprojekt. Was bedeutet das genau?
Als praxisnahes Projekt begeisterte mich die Idee eines Erlebnisprojekts im Universitätsklinikum – als bewusster Kontrast zur oft nüchternen und hektischen Atmosphäre der Hochleistungsmedizin. Inspiriert von Zegelins Hoffnungsspaziergängen wollte ich schöne und kreative Impulsorte schaffen, die zum Innehalten, Durchatmen und Ermutigen einladen. Gerade Krebspatienten brauchen eine ganzheitliche Begleitung, die nicht nur die körperlichen, sondern auch die psychischen, sozialen und spirituellen Ressourcen stärkt. Mein Ziel war es, Hoffnung erlebbar zu machen – durch Bilder, Objekte, Oasen der Ruhe und inspirierende Texte. Mit dieser Vision wandte ich mich an die Fortbildungsleitung, die Pflegedienstleitung und das Gebäudemanagement. Nach deren Zustimmung stellte ich ein interdisziplinäres Team aus onkologischer Pflege und Klinikseelsorge zusammen. Gemeinsam entwickelten wir den „Impulsspaziergang Hoffnung – ein Weg“ mit 13 Impulsorten innerhalb und außerhalb der Klinik, der Patienten, Angehörige und Mitarbeitende gleichermaßen anspricht.
Welche Ergebnisse und Erkenntnisse haben Sie aus der begleitenden Evaluierung gewonnen?
Das Ziel, einen Kontrast zur hektischen Atmosphäre des Universitätsklinikums zu schaffen, wurde erreicht. Die Besucher zeigten sich überrascht von den schön gestalteten "Oasen der Hoffnung" – ein Eindruck, der sich in Gesprächen und Fragebögen bestätigte. Insbesondere die zur Wellness-Oase umgestaltete Telefonzelle mit Meeresrauschen hinterließ Eindruck und lud zum Perspektivwechsel ein. Die Evaluation zeigt: Der Aufwand an Zeit, Kreativität und Ressourcen hat sich gelohnt – nicht nur für die Besucher, sondern auch für uns als Projektteam. Allerdings stieß das Projekt nicht nur auf Zustimmung. Die "zwecklosen" Impulsorte widersprachen dem funktionalen Klinikalltag, was viel Überzeugungsarbeit erforderte. Eine klare Vision, Begeisterung und ein starkes Team waren entscheidend für den Erfolg. Die Zusammenarbeit von onkologischer Pflege und Seelsorge erwies sich als ideal, da sie die ganzheitlichen Bedürfnisse der Patienten und Angehörigen aus der täglichen Erfahrung heraus verstanden. Ein besonderer Meilenstein war die feierliche Eröffnung des Impulsspaziergangs, der von einem vier Personen umfassenden Team aus Pflege und Klinikseelsorge gestaltet wurde. Dies zeigte, dass wir kreativ und mit einem spürbaren Mehrwert für die Klinik etwas bewegen können. Das Projektteam erhielt die Empfehlung, den Impulsspaziergang dauerhaft in den Klinikalltag zu integrieren. Die Kombination aus Kunst, Natur, Klängen und Texten – sowohl besinnlich als auch humorvoll – erwies sich als besonders wirkungsvoll. Die Evaluation mit 73 Teilnehmenden bestätigte die positive Resonanz: Rund 78 Prozent empfanden das Projekt als wohltuende Abwechslung, über 55 Prozent fühlten sich innerlich gestärkt und rund 72 Prozent würden den Spaziergang weiterempfehlen. Die offenen Rückmeldungen zeigten Dankbarkeit: Angehörige fanden Ruhe und Kraft in der Wartezeit, Patienten berichteten von Trost, Perspektivwechsel und Erleichterung. Viele wünschten sich ähnliche Angebote auch in anderen Kliniken. Ein Verbesserungsvorschlag bezog sich auf eine bessere Ausschilderung der Impulsorte.
Ihre Initiative will Hoffnung in der onkologischen Pflege vermitteln. Warum ist dieses Thema so wichtig, und wie können Pflegende selbst Hoffnung in der Pflege gezielt fördern?
In der onkologischen Pflege sind wir täglich mit Krankheit, Leiden und Sterben konfrontiert. Viele Patienten fühlen sich verzweifelt, ihre Lebensperspektive erscheint aussichtslos. Diese Hoffnungslosigkeit verursacht seelischen Schmerz – einen spirituellen Schmerz. Hoffnung ist nach Viktor Frankl eine grundlegende menschliche Kraft. Sie gibt Halt und Motivation, selbst in Krisenzeiten. Pflegewissenschaftlerin Zegelin betont, dass Hoffnung zu den Kernkompetenzen der Pflege gehört, da sie ein wesentlicher Bestandteil der Gesundheitsförderung ist. Pflegende können Hoffnung vermitteln, indem sie Patienten mit dem verbinden, was ihnen Sinn und Ziel gibt – das ist Spiritual Care. Dabei ist hoffnungsfördernde Pflege immer individuell. Sinneserfahrungen wie Düfte, Blumen oder Naturerlebnisse können wohltuend wirken. Gespräche über Ziele und Hoffnungen helfen Patienten, realistische Perspektiven zu entwickeln und ihre Fantasien schweifen zu lassen. Und: Beziehungen geben Kraft – sei es durch ein Lächeln, sichtbare Familienbilder, eine Berührung oder die Förderung von Kontakten zu Angehörigen. Patienten schöpfen Hoffnung, wenn sie sehen, dass sie trotz Krankheit noch etwas bewirken können. Um Hoffnung vermitteln zu können, müssen sich Pflegende auch mit ihrer eigenen Spiritualität auseinandersetzen: Was gibt mir selbst Halt und Sinn? Wer sich diese Frage stellt, kann Patienten einfühlsam und wertfrei begegnen – und damit ein wertvolles Samenkorn der Hoffnung säen.
Welche Empfehlungen haben Sie für andere Kliniken, die ähnliche Projekte zur Verbesserung der Lebensqualität ihrer onkologischen Patienten umsetzen wollen?
Zur Förderung der Lebensqualität onkologischer Patienten ist die Integration von Spiritual Care in den Klinikalltag unerlässlich. Spiritual Care stärkt die psychischen Ressourcen der Patienten durch die Förderung von Sinn, Hoffnung und Selbstwertgefühl. Ein wirkungsvolles Projekt ist ein Impulsspaziergang durch die Klinik, bei dem kreativ gestaltete Stationen mit Bildern, Objekten und Naturmomenten zur Besinnung und Ermutigung einladen. Auch eine Patientenmappe mit inspirierenden Texten und Bildern kann besonders bettlägerigen Patienten Weite in Kopf und Herz schenken. Ich habe den Hoffnungsweg darin abgebildet. Humor ist ein weiterer wichtiger Impulsgeber: Die humorvollen Zeichnungen von Andrea Lienhart, etwa mit dem Spruch "Man muss mit allem rechnen, auch mit dem Guten", lösen oft ein Schmunzeln aus und helfen, Ängste abzubauen. Auch die Klinikkapelle kann als spiritueller Impulsort in den Hoffnungsweg integriert werden. Besonders in den Wartebereichen der Bestrahlungsstationen oder Tageskliniken können diese Angebote Patienten gezielt erreichen. Um ein solches Projekt erfolgreich umzusetzen, braucht es Visionen, Tatkraft und ein engagiertes Team. Die Überzeugungsarbeit bei der Klinikleitung braucht Zeit, da Genehmigungen und finanzielle Mittel benötigt werden. Die Eröffnung kann mit einer Fachveranstaltung wie einem Kongress, einem Palliativsymposium oder einem Patiententag kombiniert werden. Ein Masterstudiengang Pflege könnte solche Projekte initiieren und begleiten. Jede Klinik hat besondere Orte – einen Teich, eine Bank mit Aussicht, ein Kunstobjekt – die in einen Hoffnungsweg integriert werden können. Eine kleine Tafel mit einem inspirierenden Text macht daraus einen Ort der Inspiration. Diese Orte der seelischen Erholung machen neben der medizinischen Versorgung jede Klinik einzigartig. Es wäre wünschenswert, wenn solche Projekte langfristig Bestand hätten – ganz im Sinne Zegelins: "Kliniken sollten immer Orte der Hoffnung sein."