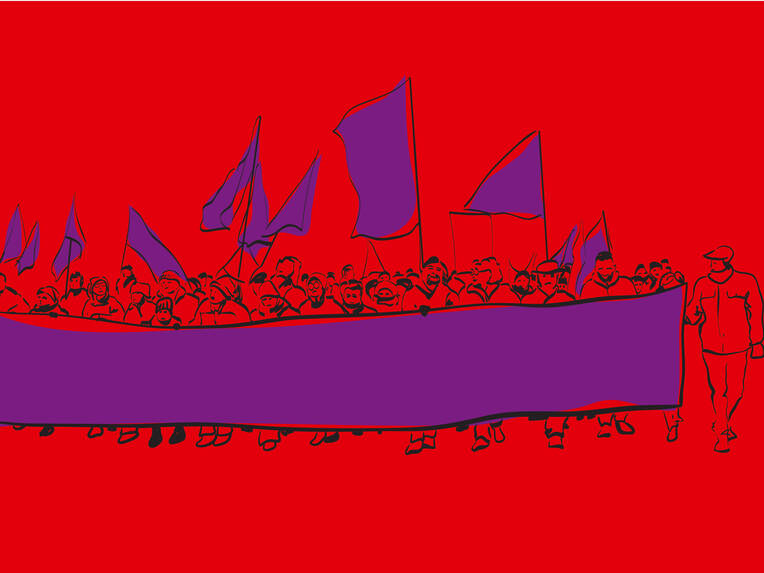Die aktuellen Proteste von Pflegefachpersonen gegen ihre eigene Kammer führten abermals vor Augen, wie sehr die berufliche Sozialisation die Entwicklung einer starken pflegerischen Identität behindert. Unser Autor plädiert für dialogische Formate, die Pflegefachpersonen ernsthaft in die Entwicklung ihres beruflichen Selbstverständnisses einbeziehen – jenseits hegemonialer Strukturen und normativer Vorgaben.
Als Krankenpflegeschüler stand ich einmal im Stationszimmer, um beim Transportdienst eine Fahrt anzumelden. Das war zu einer Zeit, als Telefone noch an einer Schnur hingen und man in einen „Knochen“ sprach, den man nach dem Telefonat auf eine Gabel legte. Plötzlich kam der Chefarzt um die Ecke, im Schlepptau die Stationsschwester. Er schlug mit der Hand auf die Gabel und nahm mir den Hörer aus der Hand. Die Stationsschwester stand wortlos daneben und blieb einzig dem Chefarzt zugewandt. Ich zog mich schockiert, aber ohne Protest zurück.
So hat über Jahrzehnte die berufliche Sozialisation von Krankenschwestern und Krankenpflegern funktioniert: Ärztliche Hybris hielt das Pflegepersonal klein – durch Worte, Gesten, Verhalten. Pflegerische Führungskräfte stützen diese Strukturen mit wortloser Passivität.
Pflegebasis versus Pflegeelite
Unter den aktuellen Mechanismen gesellschaftlicher Machtzuteilung erscheint der Ruf nach Professionalisierung, Akademisierung und Verkammerung als objektiv einzig richtiger Ausweg aus der erlernten Hilflosigkeit. Doch warum greifen die berufspolitischen Initiativen nicht? Warum gehen Pflegefachpersonen eher für die Abschaffung ihrer Kammer auf die Straße als für die Verbesserung der eigenen Arbeitsbedingungen?
Der brasilianische Pädagoge und Autor Paulo Freire (1921–1997) hat in seiner 1968 erstmals veröffentlichten „Pädagogik der Unterdrückten“ die Mechanismen beschrieben, mit denen Unterdrücker nicht nur ihre materielle, sondern auch ihre kulturelle Hegemonie erhalten und wie sie sich dafür mit Teilen der Unterdrückten verbünden [1].
Für die berufliche Pflege hat die Amerikanerin Susan Jo Roberts 1983 diese Mechanismen detailliert beschrieben und überzeugend erklärt, warum beruflich Pflegende sich selbst gering schätzen und die Zustände, unter denen sie arbeiten, weitgehend wehrlos hinnehmen: Ihnen wurde beigebracht, sich für wertlos zu halten [2]. Aus diesem Grund verhallen auch die zahllosen Aufrufe an Pflegefachpersonen, sich berufspolitisch zu organisieren. Noch destruktiver ist das Metajammern der „Pflegeelite“ über die angeblich immer nur jammernde, träge Berufsgruppe, was das Gefühl der Wertlosigkeit bei den Beschimpften verstärkt.
Die Soziologin Margit Weihrich und der Soziologe Wolfgang Dunkel wunderten sich 2012 darüber, dass die berufliche Pflege ihre Professionalisierung in der Nachahmung der Strukturen der hegemonialen Gruppe der Ärzteschaft sucht [3]. Akademisierung, Verkammerung und Spartengewerkschaft leiten sich von Vorbildern der Ärzteschaft ab, ohne die Strukturen selbst infrage zu stellen. Die Pflegewissenschaftlerin Jette Lange hat in ihrer Dissertation in beeindruckender Weise analysiert, wie der vermeintliche Kern pflegerischer Professionalität, nämlich der Pflegeprozess, mit der Unterwerfung unter eine fachfremde, betriebswirtschaftliche Logik einhergeht [4].
Meine These: Der Widerstand gegen all diese Konstrukte bis hin zu persönlichen Angriffen auf ehrenamtlich tätige Personen in den Pflegekammern, denen unterstellt wird, aus egoistischen Motiven zu handeln, hat die tiefere Ursache in dem Verdacht, die pflegerische Elite könnte sich mit Politik und Ärzteschaft gegen die eigene pflegerische Basis verbündet haben.
Paulo Freire bezeichnet es als Fehler, wenn Aktivisten Slogans vorgeben, hinter denen sich die „Unterdrückten“ versammeln sollen. Sie reproduzierten damit nur die Mechanismen der Marginalisierung. Bewerten also die Gegnerinnen von Pflegekammern diese als Institutionen, die unterdrückende Kontrollmechanismen reproduzieren? Kritisieren sie die Akademisierung der Pflege so heftig, weil sie darin eine weitere Entwertung ihrer Arbeit erleben?
Die bloße Negierung dieser Haltungen oder, um im pflegerischen Jargon zu bleiben, ihre Invalidierung hatte bisher keinen Erfolg. Was also stattdessen tun? Freire gründete Basisgemeinden, in denen die „Unterdrückten“ ohne Vorgaben des begleitenden pädagogischen Personals zunächst einmal einen sprachlichen Ausdruck für ihre Welt und ihr Erleben entwickelten und danach möglichst in die politische Aktion kamen. Ein sehr langwieriger Prozess, dessen späte Wirkung wir heute erleben, wenn zum Beispiel Angehörige indigener Gemeinschaften deutsche Unternehmen wegen der Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen verklagen.
Es braucht Formate des Zuhörens
Trotz der eingangs beschriebenen unangenehmen Erfahrung wurde aus mir doch noch ein Stationsleiter, der die Auseinandersetzung mit Ärztinnen und Ärzten suchte, deren Diagnostik und Therapie kritisch hinterfragte sowie die Stationsabläufe nicht ärzte-, sondern patientenorientiert zu gestalten versuchte.
Ohne damals von Paolo Freire gewusst und seine Bücher gelesen zu haben, anverwandelte ich seine pädagogischen Überlegungen mit den Möglichkeiten eines pflegerischen Stationsleiters. So gab es im Rahmen regelmäßiger Stationsbesprechungen viel Raum für die Mitglieder meines Teams, über Erlebnisse im Berufsalltag zu sprechen und Abläufe auf der Station mitzugestalten. Solche Ideen finden sich heute im Konzept des „New Work“ oder in der Bewegung des Magnet-Krankenhauses wieder. Aber Vorsicht: Werden diese Ansätze mit einer echten emanzipativen Intention verfolgt oder sind sie Sozialtechniken, um die Arbeitsleistung zu erhöhen? Eine Frage, die auch für die Angebote zur Verbesserung von Resilienz gestellt werden muss. Beides ist möglich. Es ist eine stete Gratwanderung.
Insbesondere Leitungspersonen, die solche Angebote buchen, sollten sich diese Frage stellen. Sie sind nicht selten identisch mit denjenigen, die die Professionalisierung der Pflege vorantreiben. Wollen sie emanzipierte Pflegefachpersonen, die dann unbequem werden? Akzeptieren sie es, wenn Pflegefachpersonen womöglich ganz andere Wege der Professionalisierung gehen wollen als Akademisierung und Verkammerung? Fragen über Fragen.
Ich möchte mit einer Erfahrung als Erwachsenenbildner und „empCARE“-Trainer schließen. Als wir vor zehn Jahren begannen, „empCARE“ zu entwickeln, wappneten wir uns vor der möglichen Kritik, dass ein empathiebasiertes Entlastungskonzept doch auch wieder nur weiße Salbe sei. Und tatsächlich konfrontierten uns Teilnehmende gelegentlich genau mit diesem Vorwurf. Zu unserer eigenen Überraschung allerdings sehr selten. Wir erleben in unseren Seminaren auch nicht die viel beschworene Jammerkultur. Unser Geheimnis? Wir hören zu und verzichten auf normative Vorgaben, wie eine Pflegefachperson zu sein hat. Wir schaffen einen Raum für die Reflexion des eigenen pflegerischen Handelns und Berufsverständnisses. Wir verstehen „empCARE“ als Angebot zur Professionalisierung pflegerischer Interaktion und der Pflegeberufe jenseits von bestimmten Strukturen [5].
Wenn Pflegekammern ihren Bestand sichern wollen, brauchen sie Formate des Zuhörens, in denen ihre Mitglieder das berufliche Selbstverständnis gemeinsam entwickeln.
[1] Freire P. Pedagogy of the oppressed. New York: The Continuum International Publishing Group; 2005
[2] Roberts SJ. Oppressed group behavior: Implications for nursing. Advances in Nursing Science 1983; 5 (4): 21–30
[3] Dunkel W, Weihrich M. Interaktive Arbeit. Theorie, Praxis und Gestaltung von Dienstleistungsbeziehungen. Wiesbaden: Springer; 2012
[4] Lange J. The Nursing Process as a Strategy for a (De-)Professionalization in Nursing. A Critical Analysis of the Transformation of Nursing in Germany in the 1970s and 1980s. V&R unipress Universitätsverlag Osnabrück; 2024
[5] Thiry L, Kaschull K, Kocks A. Pflege braucht Empathie – für andere und für sich selbst. Die Schwester | Der Pfleger 2025; 64 (6): 70–74